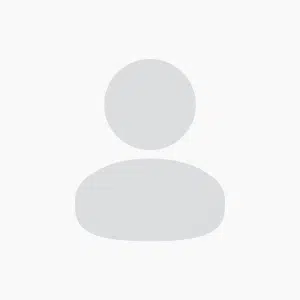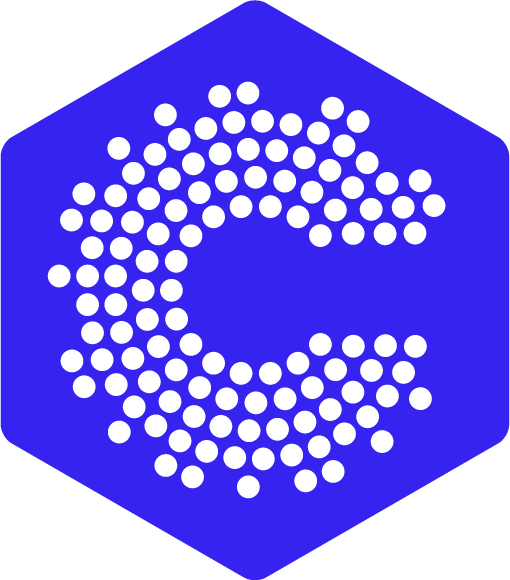Pauschalentgelt während der Elternzeit

In der Praxis stellt sich im Zusammenhang mit Pauschalentgeltvereinbarungen häufig die Spezialfrage, wie Unternehmen mit Überzahlungen während der Elternteilzeit umgehen. Grundsätzlich sind Elternteilzeit und regelmäßige Mehrarbeit nicht miteinander vereinbar, ein ausdrückliches Verbot besteht aber nicht. Arbeitgeber haben oftmals ein berechtigtes Interesse daran, während der Elternteilzeit keine Überzahlungen für Mehrarbeit auszahlen zu müssen, die die Mitarbeiter in der Regel nicht leisten und die der Arbeitgeber auch nicht einseitig abrufen kann.
In der Judikatur wurde dieses Thema bisher ausschließlich betreffend Überstundenpauschalen behandelt und hier wird die Meinung vertreten, dass diese für den Zeitraum der Elternteilzeit ruhen. Lediglich allfällige, tatsächlich geleistete Mehr- und Überstunden sind dann zu vergüten. Für All-in-Vereinbarungen gibt es bis dato keine vergleichbare, explizite Entscheidung. In jenen Fällen, in denen aus der All-in-Vereinbarung aber klar ersichtlich ist, welcher Teil der Überzahlung für Mehr- und Überstundenarbeit gewährt wird, lässt sich – in Übereinstimmung mit anderen Lehrmeinungen – eine analoge Anwendung der Rechtsprechung zu Überstundenpauschalen argumentieren.
Eine solche Zuordnung der Leistungen für Mehr- und Überstundenarbeit müsste bei allen Entgeltvereinbarungen, die seit dem 1. Jänner 2016 abgeschlossen wurden, möglich sein. Demnach müsste der Arbeitgeber während einer aufrechten Elternteilzeit jenen Anteil des All-in-Entgelts, der explizit für die Leistung von Mehr- und Überstunden gewährt wird, unseres Erachtens nicht auszahlen. Sollte aber tatsächlich Mehrarbeit geleistet werden, so ist diese (mit den entsprechenden Zuschlägen) einzeln zu vergüten.
Transparentes Abrechnen der Bezüge gewährleisten
Bei Fälligkeit des Entgelts muss das Unternehmen dem Arbeitnehmer eine schriftliche, übersichtliche, nachvollziehbare und vollständige Abrechnung von Entgelt und Aufwandsentschädigungen übermitteln (§ 2f Abs.1 AVRAG). Die Abrechnung sollte neben einer Auflistung der für die Lohnzahlungsperiode gebührenden Bruttobezüge (beziehungsweise Nettobezüge, falls dies vereinbart wurde) auch die Beiträge an die Betriebliche Mitarbeitervorsorgekasse oder Beiträge zu einer Pensionskasse beziehungsweise Betrieblichen Kollektivversicherung beinhalten. Wichtig ist überdies, dass aus der Abrechnung die jeweiligen Bemessungsgrundlagen für die Bezüge ersichtlich sind. Zudem muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsverhältnisses unverzüglich eine Kopie der Anmeldung zur Sozialversicherung aushändigen.
In der Praxis scheint die Abrechnung der Bezüge mittlerweile weitgehend transparent zu funktionieren. Zusätzlich dazu sind Arbeitgeber verpflichtet, Mitarbeitern auf deren Verlangen monatlich eine übersichtliche, vollständige und richtige Arbeitszeitaufzeichnung auszuhändigen. Nur mit ordnungsgemäßen Aufzeichnungen sind die Mitarbeiter in der Lage, ihre Ansprüche nachzuprüfen. Gängige Arbeitszeitaufzeichnungssoftware verfügt üblicherweise über entsprechende Funktionen, die den Mitarbeitern derartige Übersichten übermitteln können.
Einkommensberichte erstellen
Jeder Arbeitgeber, der dauerhaft mehr als 150 Arbeitnehmer beschäftigt, ist seit Anfang Jänner 2014 verpflichtet, alle zwei Jahre in anonymisierter Form einen Einkommensbericht zu erstellen. Darin müssen Unternehmen über die Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter nach Geschlechtern getrennt Auskunft geben (§ 11a GlBG): Für die jeweiligen kollektivvertraglichen Verwendungsgruppen und Verwendungsgruppenjahre ist die Anzahl der Frauen und Männer in diesen Gruppen sowie das errechnete Durchschnitts- oder Medianentgelt im Kalenderjahr anzugeben. Auf betriebliche Verwendungsgruppen ist ebenfalls einzugehen, sofern solche angewandt werden.
Dies bietet den Mitarbeitern zumindest einen groben Vergleichswert, wie sich ihr Gehalt im Vergleich zum Durchschnitt darstellt. Der Betriebsrat hat einen Anspruch auf die Übermittlung des Einkommensberichts. In Unternehmen, die keinen Betriebsrat haben, können die Arbeitnehmer den Bericht verlangen. Dieses Recht können sie auch vor Gericht einklagen. Auf der anderen Seite trifft die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Verschwiegenheitspflicht über den Inhalt des Einkommensberichts, deren Verletzung mit einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 360 Euro bedroht ist.
Der Verschwiegenheitspflicht nicht entgegen steht jedoch das Recht der Arbeitnehmer, Rechtsauskünfte oder Rechtsberatung einzuholen, Ansprüche gerichtlich geltend zu machen oder ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission einzuleiten. Der Gesetzgeber verfolgt mit der Pflicht zur Erstellung eines Einkommensberichts vorrangig das Ziel, eine Einkommenstransparenz und damit eine Gleichstellung von Frauen und Männern zu erreichen.
Fazit
Obwohl die Transparenzbestimmungen zum Entgelt schon seit längerer Zeit gelten, zeigen die Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis, dass Unternehmen vor allem bei der Umsetzung besonderer und nicht standardisierter Fälle nach wie vor Schwierigkeiten haben. Die Arbeitgeber sind gut beraten, diese Zweifelsfälle für sich zu klären. Denn mögliche Rechtsfolgen bei Verstößen wirken isoliert betrachtet zwar überschaubar, doch vor allem dauernde oder wiederholte Rechtsverletzungen der Transparenzbestimmungen können – vor dem Hintergrund des Kumulationsprinzips – erhebliche finanzielle Auswirkungen haben.
Angabepflicht des Grundgehalts in All-in-Vereinbarungen
In Arbeitsverträgen finden sich häufig All-in-Klauseln, mit denen sämtliche Mehrarbeits- und Überstunden sowie sonstige Leistungen wie Rufbereitschaften, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, Reisezeiten, Zuschläge und Zulagen abgegolten werden sollen. Solche Pauschalentgeltvereinbarungen sind rechtlich zulässig, sofern der Arbeitnehmer im Durchschnitt nicht schlechter gestellt wird, als er bei Einzelverrechnung der Mehr- und Überstundenleistungen gestellt wäre.
Reicht das vertragliche All-in-Gehalt im Durchschnitt nicht zur Abdeckung der tatsächlichen Arbeitsleistung (zuzüglich allfälliger Zuschläge) aus, sind diese Leistungen eigens abzugelten. Die Beurteilung erfolgt anhand einer Vergleichsrechnung, der sogenannten Deckungsprüfung. Als Beobachtungszeitraum für die Deckungsprüfung wird – mangels anderer Vereinbarungen – üblicherweise das Kalenderjahr herangezogen. Aus Gründen der besseren Transparenz für die Deckungsprüfung sieht das Gesetz für alle Pauschalentgeltvereinbarungen, die nach dem 1. Jänner 2016 abgeschlossen wurden, eine Verpflichtung vor, das Grundgehalt für die Normalarbeitszeit schriftlich als Betrag anzugeben (§ 2 Abs. 2 Z 9 AVRAG).
Nicht mehr ausreichend ist demnach die bloße Angabe einer Gesamtsumme, die der Arbeitnehmer für seine Arbeitsleistungen erhalten soll und die das Grundgehalt sowie andere Entgeltbestandteile einschließt. Vielmehr muss der Arbeitgeber zumindest das Grundgehalt als gesonderten Betrag im Dienstzettel beziehungsweise Dienstvertrag angeben (ein Verweis auf den Kollektivvertrag und die entsprechende Einstufung reicht dabei nicht aus).
Er muss nicht zwingend das kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt heranziehen, auch wenn dies in der Praxis häufig so verstanden und daher in All-in-Vereinbarungen aufgenommen wird. Dies macht aus Arbeitgebersicht in den meisten Fällen auch Sinn: Je niedriger das Grundgehalt, desto höher die (freiwillige) Überzahlung, die zur Abdeckung der geleisteten Überstunden- und Mehrarbeit herangezogen werden kann.
Im Einzelfall kann es allerdings durchaus sinnvoll sein, ein höheres als das kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt als Grundgehalt zu vereinbaren (etwa dann, wenn ein sehr niedrig angesetztes Grundgehalt den Bewerber von der Unterzeichnung des Vertrages abhalten würde); dagegen wäre gesetzlich jedenfalls nichts einzuwenden. Generell ist noch abzuwarten, ob künftige Gemeinsame Prüfungen aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA) das Heranziehen des Mindestgehaltes als Grundgehalt vorbehaltlos akzeptieren; es gibt Meinungen, die davon ausgehen, dass dies jedenfalls dann unzulässig sein soll, wenn das Mindestgehalt erheblich unter dem marktüblichen Branchenniveau liegt.
Für den Fall, dass in der All-in-Vereinbarung nicht das Grundgehalt, sondern lediglich eine Gesamtsumme, ausgewiesen ist, hat der Arbeitnehmer zwingend Anspruch auf jenes Grundgehalt einschließlich der branchen- und ortsüblichen Überzahlungen, das am Arbeitsort vergleichbare Arbeitnehmer von vergleichbaren Arbeitgebern erhalten (sogenanntes Ist-Grundgehalt).
Werden also Grundgehalt und Überzahlung nicht gesondert ausgewiesen, so hat der Arbeitnehmer nicht nur Anspruch auf das kollektivvertragliche Mindestentgelt, sondern auf das branchen- oder ortsübliche Entgelt. Der vorzunehmenden Deckungsprüfung ist daher ebenfalls eine branchenübliche Bezahlung zugrunde zu legen. In diesen Fällen ist die Gefahr einer strafbaren Entlohnung besonders hoch.
Verstöße und Strafen
Die möglichen finanziellen Auswirkungen einer Verletzung der Angabepflicht für den Arbeitgeber zeigen sich deutlich an folgendem Beispiel: Mit Arbeitnehmer X wurde ein Pauschalentgelt von 4.000 Euro vereinbart; das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt 2.500 Euro, das branchenübliche Grundgehalt 3.000 Euro. Ist nun das Grundgehalt von X nicht ausdrücklich in der Vereinbarung ausgewiesen, muss vom branchenüblichen Grundgehalt (also 3.000 Euro) ausgegangen werden, weshalb der Arbeitgeber nur Mehrleistungen im Wert von insgesamt 1.000 Euro (und nicht 1.500 Euro) abrufen kann, wobei die Summe von 1.000 Euro die Überstunden und Mehrarbeitszuschläge komplett abdecken muss.
Insbesondere in Branchen, in denen die Arbeitnehmer üblicherweise (deutlich) über dem kollektivvertraglichen Mindestniveau entlohnt werden (wie zum Beispiel in der Industrie), ist also Vorsicht geboten: Die fehlende Angabe des Grundgehalts in All-in-Vereinbarungen kann für Unternehmen zu erheblichen Mehrkosten beziehungsweise Strafen führen. Zu beachten ist nämlich, dass eine negative Deckungsprüfung am Ende des Betrachtungszeitraums (somit in der Regel am Ende des Kalenderjahres) zu einem strafbaren Lohndumping führt, wenn der Arbeitgeber das fehlende Entgelt nicht nachentrichtet.
Gehaltsangaben in Stellenausschreibungen
Bereits seit 1. März 2011 müssen Unternehmen das Mindestentgelt für eine ausgeschriebene Position in Stellenausschreibungen angeben. Die Praxis zeigt jedoch, dass nach wie vor zahlreiche Inserate keine korrekten Gehaltsangaben enthalten.
Das Gesetz sieht grundsätzlich vor, dass Arbeitgeber, private Arbeitsvermittler und mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Personen des öffentlichen Rechts in Ausschreibungen das für den Arbeitsplatz geltende Mindestentgelt angeben und auf die Bereitschaft zur Überzahlung hinweisen müssen, wenn eine solche besteht. Die Stellenausschreibung hat also jenes Entgelt mit einem konkreten Euro-Betrag auszuweisen, das als Mindestgrundlage für die Arbeitsvertragsverhandlungen zur Vereinbarung des Entgelts dienen soll.
Die in Stellenausschreibungen anzugebenden Mindestentgelte können in Kollektivverträgen, Gesetzen oder anderen Normen der kollektiven Rechtsgestaltung festgelegt sein. Bei der Angabe von Verhandlungsbandbreiten ist zu beachten, dass der niedrigere Betrag jedenfalls nicht unter dem kollektivvertraglichen Mindestgrundgehalt liegt.
Arbeitgeber müssen in Stellenausschreibungen nicht unbedingt den anzuwendenden Kollektivvertrag angeben. Auch zusätzliche Einstufungskriterien, zum Beispiel Dienstjahre bei anderen Arbeitgebern oder Tätigkeitsbeschreibungen, müssen sie nur dann zwingend nennen, wenn sie nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin mit Berufserfahrung suchen.
Die genannten Vorgaben gelten für alle internen und externen Veröffentlichungen, die sich auf einen konkreten Arbeitsplatz beziehen. Darunter fallen Inserate in Zeitungen, im Intra- und Internet sowie am Schwarzen Brett im Unternehmen. Allgemeine Hinweise auf Schildern oder Einladungen zu einem „Get-together“ beziehungsweise den immer häufigeren „Alumni-Treffen“ erfüllen den Begriff der Ausschreibung demgegenüber in der Regel nicht und führen daher auch nicht zu einer Gehaltsangabepflicht.
Welche Sanktionen gibt es?
Auch jene Unternehmen, die keiner lohngestaltenden Vorschrift wie etwa einem Kollektivvertrag unterliegen, müssen seit 1. August 2013 in ihren Stellenausschreibungen verpflichtend ein Mindestentgelt ausweisen. Das gilt auch für Ausschreibungen, die sich auf Teilzeitbeschäftigungen, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und unechte Ferialpraktika beziehen.
Für den Fall eines Verstoßes gegen die Pflicht zur Gehaltsangabe sind Sanktionen vorgesehen: Bei erstmaligem Verstoß kann die Bezirksverwaltungsbehörde eine Verwarnung aussprechen. Im Wiederholungsfall ist eine Verwaltungsstrafe in Höhe von bis zu 360 Euro vorgesehen. Sowohl der Stellenbewerber als auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft kann Verwaltungsstrafen beantragen.
Sowohl fehlende als auch falsche Angaben können sanktioniert werden. Da bei der Verhängung von Verwaltungsstrafen – wenn auch immer wieder heftig diskutiert – nach wie vor das Kumulationsprinzip gilt, können systematische Verstöße gegen die Gehaltsangabepflicht zu empfindlichen Geldstrafen für Unternehmen führen: Aufgrund eines falschen Inserats können sich mehrere Stellenbewerber beschweren, was möglicherweise auch mehrere Verwaltungsstrafen nach sich zieht. Wenn Arbeitgeber eine Jobanzeige, die nicht den rechtlichen Vorgaben entspricht, mehrfach schalten, wird zudem jede Schaltung als eigener Fall beurteilt und bestraft.