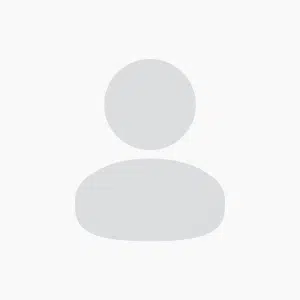Problempunkt

Die Klägerin des Ausgangsverfahrens nahm den Arbeitgeber K ihres verstorbenen Ehemanns E auf Urlaubsabgeltung in Anspruch. Dieser war seit dem 1.8.1998 bei dem Beklagten beschäftigt gewesen. Von 2009 bis zu seinem Tod am 19.11.2010 war er aufgrund einer schweren Erkrankung mit Unterbrechungen arbeitsunfähig. Bis E verstarb, hatte er unstreitig 140,5 Tage offenen Jahresurlaub angesammelt, deren Abgeltung die Klägerin als Erbin nun verlangte. Das ArbG wies die Klage ab, da ein Anspruch auf Abgeltung des bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommenen bezahlten Jahresurlaubs im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Tod des Arbeitnehmers nicht entstehe (vgl. BAG, Urt. v. 20.9.2011 – 9 AZR 416/10). Das LAG Hamm setze das Verfahren aus und wollte im Wege einer Vorabentscheidung vom EuGH wissen, ob das Unionsrecht einzelstaatliche Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten gestattet, wonach im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Tod des Arbeitnehmers der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub ohne Begründung eines Abgeltungsanspruchs für nicht genommenen Urlaub untergeht. Ferner wollte es wissen, ob eine solche Abgeltung von einem Antrag des Betroffenen im Vorfeld abhängt.
Entscheidung
Der EuGH verneinte die Vorlagefragen. Es ist danach mit der Richtlinie über die Arbeitszeitgestaltung (RL 2003/88/EG), die einen Anspruch auf einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen vorsieht, unvereinbar, wenn dieser Anspruch mit dem Tod des Arbeitnehmers ersatzlos untergeht. Der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub ist ein besonders bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts. Zudem stellen die Ansprüche auf Jahresurlaub und auf Bezahlung während des Urlaubs zwei Aspekte eines einzigen Anspruchs dar. Vor diesem Hintergrund hatte der EuGH bereits entschieden, dass es gegen das Unionsrecht verstößt, wenn langzeiterkrankte Beschäftigte nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine Abgeltung für krankheitsbedingt nicht genommenen Urlaub erhalten (EuGH, Urt. v. 20.1.2009 – C-350/06, NZA 2009, S. 135, „Schultz-Hoff“, dazu auch Methfessel, AuA 5/09, S. 276 ff.). Der vom Unionsgesetzgeber u. a. in Art. 7 der RL 2003/88/EG verwendete Begriff „einen bezahlten Mindestjahresurlaub“ bedeutet, dass für die Dauer des Jahresurlaubs im Sinne dieser Vorschrift das Entgelt beizubehalten ist. Mit anderen Worten muss der Mitarbeiter in dieser Ruhe- und Entspannungszeit das gewöhnliche Entgelt weiterbeziehen. Um dies sicherzustellen, darf der Gerichtshof Art. 7 Abs. 2 der RL 2003/88/EG nicht auf Kosten der Rechte, die dem Arbeitnehmer danach zustehen, restriktiv auslegen. Auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Tod des Beschäftigten muss deshalb durch einen finanziellen Ausgleich die Wirksamkeit des Urlaubsanspruchs sichergestellt werden. Der unwägbare Eintritt des Todes darf nicht rückwirkend zum vollständigen Verlust des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub führen. Die Urlaubsabgeltung hängt in einem solchen Fall auch nicht davon ab, dass der Betroffene im Vorfeld einen Antrag gestellt hat. Art. 7 Abs. 2 der RL 2003/88/EG stellt für die Eröffnung des Anspruchs auf finanzielle Vergütung außer der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nämlich keine weitere Voraussetzung auf.
Konsequenzen
Die EuGH-Entscheidung ändert erneut grundlegend das deutsche Urlaubsrecht. Bisher war – auch nach „Schultz-Hoff“ – anerkannt, dass mit dem Tod des Mitarbeiters der Urlaubsanspruch erlischt und dieser sich nicht nach § 7 Abs. 4 BUrlG in einen Abgeltungsanspruch umwandelt, der nach § 1922 Abs. 1 BGB vererbbar wäre (BAG v. 20.9.2011, a. a. O.; Urt. v. 12.3.2013 – 9 AZR 532/11, AuA 5/14, S. 311). Nach dem EuGH ist der gesetzliche vierwöchige Mindesturlaub auch nach dem Tod des Arbeitnehmers nicht erloschen, sondern abzugelten (an die Erben) und zwar ohne dass es im Vorfeld zu Lebzeiten eines Antrags des Beschäftigten bedarf. Mit Überraschungen aus Straßburg und Brüssel muss im Arbeitsrecht stets gerechnet
|
Praxistipp |
|
Die EuGH-Rechtsprechung bezieht sich (nur) auf den gesetzlichen Mindesturlaub. Werden – wie in der Praxis häufig – mehr Urlaubstage gewährt, ist es wichtig im Arbeitsvertrag entsprechend klar zwischen Mindest- und Zusatzurlaub zu differenzieren. |
|
Muster |
|
Urlaubsklausel |
|
(1) Der Urlaub i. H. v. 30 Arbeitstagen pro Kalenderjahr setzt sich zusammen aus dem gesetzlichen Urlaubsanspruch i. H. v. 20 Arbeitstagen sowie einem Mehrurlaub i. H. v. 10 Arbeitstagen pro Kalenderjahr (jeweils bei Fünf-Tage-Woche). (2) Dieser Mehrurlaub wird freiwillig gewährt, ohne dass es hierauf einen Rechtsanspruch gibt. Der Mehrurlaub verfällt ersatzlos spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres, auch dann, wenn die beschäftigte Person den Urlaub aus Gründen der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder aus anderen von ihr nicht zu vertretenden Gründen nicht nehmen kann. (3) Mit der Erteilung von Urlaub erfüllt der Arbeitgeber zunächst den Anspruch der beschäftigten Person auf den gesetzlichen Mindesturlaub, erst dann den Anspruch auf Mehrurlaub. (4) Ein möglicher Urlaubsabgeltungsanspruch beschränkt sich auf den jeweils noch nicht genommenen gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch. Sind bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses die über diesen gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch hinaus möglicherweise bestehenden Mehrurlaubsansprüche ganz oder teilweise nicht erfüllt, entsteht insoweit kein Urlaubsabgeltungsanspruch. |
……….
Quelle: Arbeit und Arbeitsrecht 1/15
Copyright Foto: Jorma Bork | www.pixelio.de