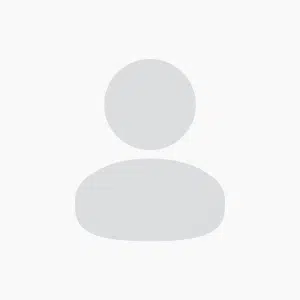1. Von der Entsendung zur illegalen Arbeitnehmerüberlassung

Eine Entsendung von Mitarbeitern eines in den EU-8-Staaten ansässigen Unternehmens nach Deutschland birgt vor allem die Gefahr, dass es sich um illegale Arbeitnehmerüberlassung handelt. Das kann erhebliche finanzielle Folgen für das deutsche Einsatzunternehmen haben, die denen einer Scheinselbstständigkeit sehr ähnlich sind. Haftungsrisiken bestehen, wenn tatsächlich gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, obwohl man mit dem ausländischen Unternehmen eine Entsendung im Rahmen eines Werk- oder Dienstvertrags vereinbart hat. Die Rechtsprechung stellt zur Abgrenzung entscheidend darauf ab, ob der Arbeitnehmer in den Betrieb des Dritten eingegliedert ist und dessen Weisungen unterliegt (z. B. BAG, Urt. v. 6.8.2003 – 7 AZR 180/03). Soweit sich Vereinbarung und tatsächliche Durchführung widersprechen, schauen die Gerichte darauf, wie die Parteien den Vertrag „leben“. Checkliste 1 nennt Indizien, die für eine Eingliederung in den Beschäftigungsbetrieb und damit eine Arbeitnehmerüberlassung sprechen.
Checkliste 1: Indizien für Arbeitnehmerüberlassung
Für Eingliederung und damit Arbeitnehmerüberlassung spricht, wenn die Fremdmitarbeiter:
- arbeitsrechtliche Weisungen des Einsatzunternehmens erhalten (z. B. durch beaufsichtigende Mitarbeiter)
- mit Arbeitnehmern des Einsatzunternehmens zusammenarbeiten
- Tätigkeiten übernehmen, die früher Arbeitnehmer des Einsatzunternehmens ausgeführt haben
- das Einsatzunternehmen Arbeitskleidung und Arbeitsmaterial stellt
- eine Aufsichtsperson des Vertragsarbeitgebers fehlt
- der Leistungsgegenstand in der Vereinbarung nur allgemein umschrieben ist
- der Vertragsarbeitgeber mangels sachlicher oder personeller Ausstattung nicht in der Lage ist, einen Werkvertrag selbstständig durchzuführen
- das Einsatzunternehmen die Anzahl der eingesetzten Arbeitnehmer, die Lage der Arbeitszeit sowie Urlaubszeiträume festlegt
Zusätzlich nimmt die Rechtsprechung eine Gesamtschau „aller für die rechtliche Einordnung der Vertragsbeziehungen wesentlichen Umstände“ vor (z. B. BAG, Urt. v. 30.1.1991 7 AZR 497/89). Dabei wägt sie alle Indizien gegen- und untereinander ab. Nachteil dieser Vorgehensweise ist die damit einhergehende Rechtsunsicherheit. Für die nternehmen – und oft auch den (arbeits-)rechtlichen Berater – ist kaum sicher absehbar, ob das Gericht ein Vertragsmodell als Werk-/Dienstvertrag oder Arbeitnehmerüberlassung einordnen wird, vgl. zum Thema auch Deich, AuA 7/09,S. 412 ff.; Hunold, AuA 1/08, S. 26 ff.; Hamann AuA 4/03, S. 20 ff.
2. Durchführungsanweisungen
Gewisse Abhilfe in der Praxis schaffen die Durchführungsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (DA AÜG; abrufbar unter www.arbeitsagentur.de oder arbeit-und-arbeitsrecht.de/ downloads). Die Bundesagentur und die jeweilige Regionaldirektion halten sich ausnahmslos daran, so dass die DA AÜG eine Risikoeinschätzung aus praktischer Sicht ermöglichen. Die Anweisungen betonen, dass bei der Unterscheidung nicht schematisch vorzugehen ist. Selbst wenn einzelne oder mehrere Kriterien vorliegen, entscheidet das noch nicht über die Einordnung. Vielmehr ist eine wertende Gesamtbetrachtung aller Kriterien vorzunehmen. Ausschlaggebend ist der vereinbarte Geschäftsinhalt. Steht er im Widerspruch zur tatsächlichen Durchführung, ist Letztere maßgeblich. Checkliste 2 nennt Kriterien, die nach den DA AÜG für einen Werkvertrag sprechen.
Für Arbeitnehmerüberlassung spricht dagegen vor allem, wenn
- der vermeintliche Werkbesteller die vertragstypischen Rechte und Pflichten eines Werkunternehmers wahrnimmt und
- die Fremdarbeitnehmer organisatorisch in seine Arbeitsabläufe eingegliedert sind.
Checkliste 2: Kriterien für einen Werkvertrag nach DA AÜG
Für einen Werkvertrag spricht, wenn der Auftragnehmer:
- unternehmerische Dispositionsfreiheit besitzt (z. B. Auswahl der eingesetzten Arbeitnehmer, Bestimmung der Arbeitszeit, Gewährung von Urlaub)
- ein dementsprechendes Weisungsrecht hat
- das unternehmerische Risiko trägt, vor allem in Gewährleistungsfällen
- aufgrund seiner personellen und materiellen Ausstattung „werkvertragsfähig“ ist
- eigene Arbeitsmittel verwendet
- es sich um ein individualisierbares und abgrenzbares Werk handelt
- die Werkleistung erfolgsorientiert abgerechnet wird
3. Erlaubnispflicht
In Deutschland bedarf die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung einer Erlaubnis, § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG. Das Gesetz sagt nicht ausdrücklich, dass es auch für grenzüberschreitende Überlassungen nach Deutschland gilt. Allerdings sieht § 3 Abs. 2 AÜG vor, die Erlaubnis zu versagen, wenn der Verleiher seine Betriebe außerhalb der EU/des EWR hat. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass das Gesetz hier Anwendung findet. Ohne Erlaubnispflicht kann eine Erlaubnis nämlich nicht versagt werden. Die Anwendbarkeit des AÜG innerhalb der EU/des EWR ergibt sich damit aus einer Auslegung der gewerberechtlichen Vorschriften des Gesetzes. Unabhängig davon nehmen Rechtsprechung und Literatur nach dem „Territorialitätsprinzip“ an, dass der Verleih aus dem Ausland ins Inland den gewerberechtlichen Regeln des AÜG unterliegt.
Wichtig
Damit besteht für die grenzüberschreitende gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung nach Deutschland Erlaubnispflicht (vgl. BAG, Urt. v. 22.3.2000 – 7 ABR 34/98). Zugleich folgt aus der Anwendbarkeit des AÜG, dass die gewerbsmäßige Überlassung aus Nicht-EU-/Nicht-EWRStaaten immer unzulässig ist, da in diesem Fall die Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 AÜG zwingend zu versagen ist.
4. Erlaubnisfreie vorübergehende Überlassung im Konzern
Als Ausnahmevorschrift kann vor allem § 1 Abs. 3 Nr. 2 AÜG relevant werden: die erlaubnisfreie vorübergehende Überlassung innerhalb eines Konzerns, vgl. auch Zürn, AuA 0/09, S. 590 ff. Die Regelung gilt auch für multinationale Konzerne, soweit eines der beteiligten Unternehmen seinen Sitz im Inland hat oder die Überlassung vom usland ins Inland erfolgt (Schüren/Hamann/Hamann, AÜG, 4. Auflage 2010, § 1 Rdnr. 491 m. w. N.). Schwierig zu beantworten ist natürlich, wie lange „vorübergehend“ ist. Das Gesetz definiert oder konkretisiert das Merkmal nicht. Ausgehend vom allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet das Wort so viel wie „nur zeitweilig“, „nur eine gewisse Zeit dauernd“ oder „momentan“. Eine klare zeitliche Grenze lässt sich allein anhand der allgemeinen Begriffsbedeutung daher nicht ziehen. Jede Angabe einer maximal zulässigen Höchstdauer in Monaten oder Jahren wäre willkürlich.
Aus der allgemeinen Wortbedeutung lässt sich aber schließen, dass eine Rückkehr auf den ursprünglichen Arbeitsplatz beabsichtigt sein muss und der Betreffende nur befristet in dem anderen Konzernunternehmen tätig werden darf (Thüsing/Waas, AÜG, 2. Auflage 2008, § 1 Rdnr. 194b). Ein konkreter Rückkehrzeitpunkt braucht aber noch nicht festgelegt sein. Nach dem Wortlaut der Vorschrift reicht es aus, wenn er bestimmbar ist(ErfK/Wank, 10. Auflage 2010, § 1 Rdnr. 60). „Vorübergehend“ heißt damit (nur) nicht endgültig“. Unter das Konzernprivileg des § 1 Abs. 3 Nr. 2 AÜG fallen daher auch langjährige Überlassungen innerhalb eines Konzerns, solange der zu überlassende Arbeitnehmer nicht endgültig aus dem Unternehmen des Verleihers ausscheiden soll.
Wichtig
Sind die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Nr. 2 AÜG erfüllt, ist das AÜG – mit Ausnahme der in der Vorschrift aufgezählten Regelungen – nicht anzuwenden. Damit entfällt vor allem die Erlaubnispflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG. Grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung ist dann ohne Erlaubnis möglich. Konzernunternehmen mit Sitz innerhalb oder außerhalb des EWR können ohne Einschränkung Arbeitnehmer an Konzernunternehmen im Inland überlassen.
5. Arbeitserlaubnis-EU
Die aufenthaltsrechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz ausländischer Arbeitnehmer in Deutschland enthalten im Wesentlichen das Freizügigkeitsgesetz/ EU, das Aufenthaltsgesetz sowie § 284 SGB III. Im Hinblick auf Angehörige der EU-8-Staaten ist zu differenzieren zwischen der Rechtslage vor und nach dem 1.5.2011:
Der EU-Beitrittsvertrag sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Arbeitnehmerfreizügigkeit für Angehörige der EU-8-Staaten bis zum 30.4.2011 beschränken können. Von dieser Möglichkeit hat Deutschland Gebrauch gemacht: Bürger der Beitrittsstaaten dürfen eine Beschäftigung nur mit Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit ausüben (§ 284 Abs. 1 SGB III). Diese wird befristet als Arbeitserlaubnis-EU erteilt. Die Genehmigung einer Beschäftigung als Leiharbeitnehmer scheitert aber an § 288 Abs. 1 Nr. 3 SGB III i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die Arbeitsgenehmigung für ausländische Arbeitnehmer (ArGV). Danach ist die Arbeitserlaubnis zu versagen, wenn der Arbeitnehmer als Leiharbeitnehmer tätig werden will. Deutsche Unternehmen dürfen daher Angehörige der EU-8- Staaten bis einschließlich 30.4.2011 nicht als Leiharbeitnehmer beschäftigen. Dem steht auch nicht die Dienstleistungsfreiheit entgegen (LSG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 7.7.2010 – L 1 AL 158/10 B ER).
Diese Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit fallen zum 1.5.2011 weg. Danach genießen auch die Angehörigen der EU-8-Staaten uneingeschränkte Freizügigkeit nach Art. 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV, ex-Art. 39 EG). Sie brauchen vor allem keinen Aufenthaltstitel und können ab diesem Zeitpunkt ohne aufenthaltsrechtliche Beschränkungen in deutschen Unternehmen eingesetzt werden – auch als Leiharbeitnehmer.
6. Haftungsrisiken
Setzt das inländische Unternehmen die ausländischen Staatsangehörigen in dem Glauben ein, es handele sich um die zulässige Entsendung zur Ausführung eines Werk- oder Dienstvertrags, obwohl tatsächlich Arbeitnehmerüberlassung vorliegt („Scheinwerk-/-dienstvertrag“), drohen erhebliche – nicht nur finanzielle – Risiken:
Ist das ausländische Unternehmen nicht im Besitz der nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG erforderlichen Verleiherlaubnis – was jedenfalls derzeit noch der Regelfall sein wird –, ist der Arbeitsvertrag mit dem ausländischen Arbeitnehmer aus nationaler Sicht unwirksam, § 9 Nr. 1 AÜG. In diesem Fall gilt ein Arbeitsverhältnis zwischen dem deutschen Einsatzunternehmen als Entleiher und dem ausländischen Arbeitnehmer als zustande gekommen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG), und zwar zu den Bedingungen im Einsatzunternehmen. Unerheblich ist dabei, ob die Entscheidungsträger des inländischen Unternehmens wussten oder hätten wissen müssen, dass es sich um illegale Überlassung handelt. Diese Folge lässt sich auch nicht durch eine Rechtswahl umgehen, da es sich bei § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG um eine Eingriffsnorm i. S. v. Art. 9 Abs. 1 der Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I-VO, früher Art. 34 EGBGB) handelt. Sie ist unabhängig von der berufenen Rechtsordnung anzuwenden (Jerczynski/Zimmermann, NZS 2007, S. 243, 249).
Eine Ausnahme gilt, wenn eine Entsendebescheinigung E-101 vorliegt. Nach der Rechtsprechung des EuGH kommt ihr Bindungswirkung zu (Urt. v. 30.3.2000 – C-178/97). Sie legt innerhalb der Mitgliedstaaten für diese verbindlich das anwendbare Sozialversicherungsrecht fest. Nichts Anderes gilt für die EU-8-Staaten nach Vollendung der Arbeitnehmerfreizügigkeit am 1.5.2011. Dann kann jedoch die Rechtsfolge – Fiktion eines Arbeitsverhältnisses im Inland – nicht anzuwenden sein. Dies hätte nämlich zur Folge, dass ein inländisches Arbeitsverhältnis besteht, der ausländische Arbeitnehmer aber aufgrund der Bindungswirkung der Entsendebescheinigung weiterhin dem ausländischen Sozialversicherungsstatut unterfällt. Es entstünde ein inländisches Arbeitsverhältnis ohne inländische Sozialversicherungspflicht. Das deutsche Sozialversicherungsrecht verknüpft durch § 7 Abs. 1 SGB IV aber Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnis untrennbar miteinander. Ein Arbeitsverhältnis ohne Sozialversicherungspflicht ist ihm grundsätzlich fremd (einzige Ausnahme: geringfügige Beschäftigung, § 8 SGB IV).
Wichtig
Liegt eine Entsendebescheinigung E-101 vor, ist daher § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG mit seiner Rechtsfolge nicht anwendbar. Es kommt kein Arbeitsverhältnis mit dem Einsatzunternehmen kraft gesetzlicher Fiktion zustande.
7. Sozialversicherungspflicht in Deutschland
Das kraft Fiktion entstandene Arbeitsverhältnis führt grundsätzlich zur Sozialversicherungspflicht in Deutschland, weil hier der Beschäftigungsort ist (§ 3 Nr. 1 SGB IV) und das durch § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG fingierte Arbeitsverhältnis zum Einsatzunternehmen ein Beschäftigungsverhältnis i. S. v. § 7 Abs. 1 SGB IV begründet (BSG, Urt. v. 25.10.1988 – 12 RK 21/87, BSGE 64, S. 145). Auch findet keine Einstrahlung des ausländischen Sozialversicherungsrechts statt. Weder nach den bisher geltenden Regelungen der Verordnung (EWG) 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern noch nach den seit dem 1.5.2010 geltenden Regelungen der Verordnung (EG) 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (vgl. dazu Münch/Neumann, AuA 9/10, S. 538 ff., in diesem Heft) ist die illegale grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung eine Entsendung (Jerczynski/Zimmermann, NZS 2007, S. 243, 249).
Das Einsatzunternehmen hat dann ggf. rückwirkend – gerade bei illegaler Überlassung wird die Beitragsforderung oft erst nach einer Betriebsprüfung gemäß § 28p SGB IV festgestellt – für die vergangenen vier Jahre (§ 25 Abs. 1 Satz 1 SGB IV) den Gesamtsozialversicherungsbeitrag (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) sowie die Beiträge zur esetzlichen Unfallversicherung zu zahlen, einschließlich Säumniszuschläge.
Praxistipp
Existiert allerdings eine Entsendebescheinigung E-101, sind die nationalen Behörden und Träger daran gebunden, auch wenn sie davon ausgehen, dass die Voraussetzungen einer Entsendung nach der VO (EG) 883/2004 nicht gegeben sind, weil illegale Überlassung vorliegt. Der Entsendebescheinigung kommt insoweit Rechtsschein zu. Erst wenn die ausstellende Behörde sie zurücknimmt, entfällt dieser. Solange das nicht der Fall ist, gilt die Bescheinigung mit der Folge, dass der Arbeitnehmer dem ausländischen Sozialversicherungsrecht unterfällt und das deutsche Sozialversicherungsrecht keine Anwendung findet. Das Einsatzunternehmen muss daher weder Sozialversicherungsbeiträge zahlen noch Säumniszuschläge.
8. Exkurs: Säumniszuschläge
Von Bedeutung für Säumniszuschläge im Zusammenhang mit grenzüberschreitender illegaler Arbeitnehmerüberlassung ist die Sonderregel des § 24 Abs. 2 SGB IV. Danach ist kein Säumniszuschlag zu erheben, wenn ein Bescheid die Beitragsforderung mit Wirkung für die Vergangenheit feststellt und der Beitragsschuldner – hier also das Einsatzunternehmen – glaubhaft macht (§ 23 SGB X), dass es unverschuldet keine Kenntnis von der Zahlungspflicht hatte. Die Unkenntnis kann darin liegen, dass es von den Tatsachen, die die Zahlungspflicht begründen, nichts wusste oder die Rechtslage fehlerhaft beurteilte. Bei der illegalen Überlassung kommt vor allem eine rechtlich unzutreffende Bewertung – ein Rechtsirrtum – in Betracht, z. B. wenn das Einsatzunternehmen davon ausging, die Arbeitnehmer würden in seinem Betrieb im Rahmen von Werkverträgen eingesetzt. Dann besteht kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, das die Zahlungspflicht auslöst. Bei grenzüberschreitender Überlassung kann ein Rechtsirrtum auch darin liegen, dass der inländische Arbeitgeber von einer wirksamen Entsendung und damit der Geltung ausländischen Sozialversicherungsrechts ausgeht.
Praxistipp
Ob die Unkenntnis unverschuldet ist, beurteilt sich mangels einer speziellen Vorschrift analog § 276 BGB. Die im Verkehr erforderliche Sorgfalt gebietet es, sich gründlich über die Rechtslage zu informieren und ggf. auch Rat von einem Spezialisten oder der zuständigen Behörde einzuholen. Insbesondere gilt dies bei schwierigen Rechtsfragen, wie der Abgrenzung von Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung sowie der sozialversicherungsrechtlichen Einstrahlung von Beschäftigungsverhältnissen. Nur wenn dies erfolgt ist und danach nicht von illegaler Arbeitnehmerüberlassung und einem inländischen Beschäftigungsverhältnis auszugehen ist, fehlt es an einem Fahrlässigkeitsvorwurf. Die Erhebung von Säumniszuschlägen ist dann gemäß § 24 Abs. 2 SGB IV zwingend ausgeschlossen.
9. Lohnsteuerhaftung
Das Einsatzunternehmen haftet außerdem für die Lohnsteuer der Arbeitnehmer gemäß § 42d Abs. 6 EStG. Es wird im Regelfall der illegalen Überlassung wirtschaftlich als Arbeitgeber i. S. d. anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens anzusehen sein. Die rein formale Arbeitgeberstellung des ausländischen Unternehmens, das den Arbeitnehmer nach Deutschland vermittelt hat, ist der Arbeitgebereigenschaft des Einsatzunternehmens vollständig untergeordnet (vgl. Mutscher/Power, IStR 2002,S. 411, 12 f.). Die Entsendebescheinigung E-101 ist für das Lohnsteuerrecht bedeutungslos, verhindert also nicht die Inanspruchnahme des Einsatzunternehmens (Hess. FG, Urt. v. 13.2.2008 – 8 K 2258/01).
Wichtig
Das Lohnsteuerrecht enthält im Gegensatz zum Sozialversicherungsrecht aber einen Haftungsausschluss: Gemäß § 42d Abs. 6 Satz 3 EStG haftet der Entleiher nicht, wenn r über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung ohne Verschulden irrte. Die Regelung nimmt darauf Rücksicht, dass im Einzelfall oft schwierig zu beantworten ist, ob Arbeitnehmerüberlassung oder eine andere Form des Fremdpersonaleinsatzes praktiziert wird.
Geht das Einsatzunternehmen etwa davon aus, es habe mit dem ausländischenVerleiher einen Werkvertrag geschlossen, irrte es i. S. d. Vorschrift über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung. Der Irrtum über die Existenz einer Überlassungserlaubnis wirkt nach dem Wortlaut des § 42d Abs. 6 Satz 3 EStG hingegen nicht haftungsbefreiend, selbst dann nicht, wenn der Verleiher den Entleiher über ihr Vorhandensein getäuscht hat.
Unverschuldet ist der Irrtum wie bei § 24 Abs. 2 SGB IV, wenn das Einsatzunternehmen analog § 276 Abs. 2 BGB bei der rechtlichen Bewertung des Personaleinsatzes die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat.
10. Ordnungswidrigkeiten und Straftaten
Ordnungswidrigkeiten und strafrechtliche Folgen für das Einsatzunternehmen können sich aus speziellen Vorschriften des AÜG (§ 16 Abs. 1 Nr. 1a AÜG) ergeben, aber auch aus allgemeinen Vorschriften, etwa dem SGB IV (Verstoß gegen Melde- und Aufzeichnungspflichten nach §§ 28a, f) und dem StGB (z. B. Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, § 266a, Betrug, § 263). Soweit die Tatbestände jedoch Sozialversicherungspflicht in Deutschland voraussetzen, insbesondere § 266a StGB, und eine Entsendebescheinigung E-101 vorliegt, ist eine Ordnungswidrigkeit oder Strafbarkeit ausgeschlossen, weil auch hier die Bindungswirkung gilt
(vgl. BGH, Urt. v. 24.10.2006 – 1 StR 44/06, AuA 8/07, S. 504 f.).
Die täterschaftliche Begehung einer Lohnsteuerhinterziehung gem. § 370 AO i. V. m. §§ 38 Abs. 3, 41a EStG durch das Einsatzunternehmen ist in aller Regel ausgeschlossen, da es nicht lohnsteuerlicher Arbeitgeber der illegal überlassenen Arbeitnehmer ist. Möglich ist aber Beihilfe zu einer Lohnsteuerhinterziehung durch den Verleiher gemäß § 27 StGB. Aus der illegalen Überlassung und etwaigen Ordnungswidrigkeiten sowie Straftatbeständen kann sich außerdem die Unzuverlässigkeit des Einsatzunternehmens i. S. d. § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO bzw. der Vorschrift des jeweiligen Spezialgesetzes ergeben. Dann droht in gravierenden Fällen die Untersagung des Gewerbes.
11. Fazit
Die volle Freizügigkeit für Angehörige der EU-8-Staaten ab dem 1.5.2011 birgt Risiken, derer sich die Einsatzunternehmen bewusst sein müssen. Sie lassen sich minimieren, indem man
- die Verträge klar nach Maßgabe der Abgrenzungskriterien der Rechtsprechung und der DA AÜG gestaltet;
- ständig sorgsam kontrolliert, dass die Verträge im betrieblichen Alltag so „gelebt“ werden, wie sie geschrieben sind;
- nur mit ausländischen Unternehmen zusammenarbeitet, die über eine Überlassungserlaubnis verfügen;
- den Einsatz auf Arbeitnehmer beschränkt, für die eine Entsendebescheinigung E-101 vorliegt. Hier muss sich das Einsatzunternehmen bei seinem ausländischen Vertragspartner erkundigen. Da die zuständigen ausländischen Behörden die Bescheinigungen auch zurücknehmen können, sollte es die aktuellen Versionen regelmäßig anfordern. Diese sind bei den Lohnunterlagen aufzubewahren, vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 13 Beitragsüberwachungsverordnung.
- Letztlich ist es wichtig, sich nur an seriöse ausländische Unternehmen zu wenden. Hier kann eine Nachfrage bei Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) in Bonn helfen.
Quelle: Arbeit und Arbeitsrecht – 9/10