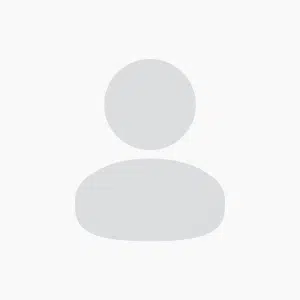Herr Prof. Veen, auf der Messe Zukunft Personal 2011 war Social Media eines der zentralen Themen. Was tut sich diesbezüglich aus Ihrer Sicht in der Arbeitswelt?

Für viele Menschen ist die Kommunikation im Netz heute genauso wichtig wie das persönliche Gespräch. Mehr noch, es bildet sich zunehmend eine Generation heraus, die in einer Welt der Vernetzung und Selbststeuerung lebt. Das bedeutet, dass Unternehmen mit einem neuen Typus Arbeitnehmer konfrontiert sind. Ich nenne diese Gruppe von Menschen „Homo Zappiens“. Das können jüngere Menschen sein, die gerade ins Arbeitsleben eintreten und mit dem Internet aufgewachsen sind, aber immer häufiger auch ältere, die sich viel im Internet bewegen.
Wie müssen Unternehmen ihr Recruiting umstellen, um diesen neuen Typus Arbeitnehmer anzusprechen?
Eigentlich braucht es dafür keine bezahlten Annoncen in Zeitungen mehr. Unternehmen können sich viel einfacher und besser mit den passenden Kandidaten in sozialen Netzwerken bekannt machen. Dort sehen sie genau, welche Interessen und Kompetenzen jemand hat. Und die persönlichen Vorlieben sind für die Netzgeneration sehr wichtig. Der neue Typus Arbeitnehmer möchte eine Arbeit, die ihn interessiert und Spaß macht. Das Gehalt ist da eher zweitrangig.
Aber die Personalverantwortlichen erkennen dieses Potenzial bisher nur selten. Sie möchten weiterhin Zertifikate und Diplome vorgelegt bekommen, wenn sich jemand bewirbt. Sie erwarten eine klassische Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und allem Drum und Dran. Das Problem dabei ist, dass die Betriebe an die richtig guten Leute, insbesondere die Informatiker und Naturwissenschaftler, so irgendwann nicht mehr herankommen. Schon heute erreichen sie auf dem klassischen Weg nur einen Bruchteil der Leute, die für sie passen würden.
Angenommen, ein Arbeitnehmer der Netzgeneration ist schon an Bord eines Unternehmens. Was gilt es dann zu beachten?
Diese Menschen wollen ihre professionelle Entwicklung selbst in die Hand nehmen und deshalb auch anders lernen. Die Entwicklung von Karrieren macht diese Generation vorwiegend nicht mehr in einem traditionellen Ausbildungszentrum des Unternehmens, sondern in Communities, indem sie Informationen austauschen und teilen. Dadurch entwickeln sie die Kompetenzen, die sie täglich im Betrieb benötigen und die ihren Wert auf dem Arbeitsmarkt ausmachen.
Wie funktioniert lernen in Communities genau?
Die Richtung der Interaktion ist zweiseitig. Wenn jemand meine Probleme löst, sollte ich auch Probleme anderer Menschen lösen. Ich gebe etwas und bekomme etwas zurück. Außerdem ist das Lernen selbstgesteuert und an die tägliche Arbeit gebunden. Die meisten netzaffinen Menschen bewegen sich in verschiedenen Communities gleichzeitig. Eine wichtige Rolle nehmen dabei Reputationssysteme ein, die erkennbar machen, von welchen Personen gute Informationen kommen. Wer sich schon länger in einem Netzwerk bewegt, kennt die Menschen natürlich auch so.
Wie muss sich folglich das Talentmanagement von Unternehmen verändern?
Eigentlich kann man Talente nicht managen, sondern nur ihre Entwicklung unterstützen. Es gilt also, die passenden Lernplattformen zur Verfügung zu stellen. Menschen der Netzgeneration möchten Einfluss nehmen auf ihre professionelle Entwicklung – etwa indem sie ihre Lehrpläne selbst bestimmen. Es wäre möglich, dass sie hinterher dafür ein Zertifikat bekommen. Doch heute funktioniert es noch immer anders herum: Wir bieten Kurse zur professionellen Entwicklung, bei der die Inhalte schon im Curriculum festgelegt sind. Ohne diese Inhalte zu lernen, gibt es keinen Abschluss und keine Chancen für bestimme Karriereoptionen.
Wie können Unternehmen dann ermitteln, welche Mitarbeiter die größten Potenziale für Führungs- und Managementpositionen haben?
Durch Peer-2-Peer-Reputationssysteme können Personalmanager leicht erkennen, wer die Kompetenzen hat, die ein Unternehmen braucht. Der einzelne Mitarbeiter wird in diesen Systemen ständig von anderen bewertet.
Neben Reputationssystemen wie zum Beispiel „Get Satisfaction“ gibt es auch welche für Communities, Blogs oder für Enterprise-2.0-Plattformen wie „Socialcast“. In allen diesen Systemen lassen sich Social-Network-Analysen leicht etablieren. Im Vergleich zu traditionellen Zertifikaten, die nur eine Momentaufnahme zeigen, bilden diese Tools auch den Entwicklungsprozess ab.
Viele Unternehmen haben Bedenken Social Media völlig frei zu nutzen, etwa weil Firmenwissen abwandern könnte. Wo sehen Sie Grenzen von freier Kommunikation in Netzwerken?
Talente kann man nicht im Unternehmen halten, ohne ihnen Freiheiten zu geben. Die guten Leute möchten ohne Einschränkung online netzwerken und die Unternehmen müssen ihnen dazu die Möglichkeit bieten. Da können Firmen noch so sehr versuchen, gute Mitarbeiter von der Außenwelt abzuschirmen. Das funktioniert nicht. Wirkungsvoller für die Mitarbeiterbindung ist es, eine spannende Arbeit mit allen nötigen Freiheiten zu bieten. Natürlich können daraus Probleme entstehen, aber Angst ist dennoch ein schlechter Ratgeber.
Über welche Tools tauschen sich die Mitarbeiter der neuen Generation vorwiegend aus?
Neben Facebook, LinkedIn oder Xing spielen dabei vor allem professionelle Netzwerke eine Rolle – wie zum Beispiel Stack Overflow oder Slashdot für Programmierer. Auf Slashdot sind unter anderem viele Google-Mitarbeiter. Geheimnisse von Google sind dabei kein Thema, obwohl offen diskutiert wird. Die Leute, die bei Google arbeiten, fühlen sich offenbar wohl und identifizieren sich mit den Interessen des Unternehmens. Das hört sich vielleicht etwas naiv an. Und sicherlich hat kein Unternehmen eine Garantie, dass es immer so läuft. Aber gerade in diesen spezifischen Communities sind auch immer Kollegen aktiv und dadurch entsteht eine gewisse soziale Kontrolle.
Wer darauf nicht vertraut, kann immer noch ein unternehmensinternes Netzwerk aufbauen. Shell etwa hat ein eigenes soziales Netzwerk, in dem Ingenieure von Ölplattformen ihre Kenntnisse austauschen und sich zusammen neue technische Lösungen überlegen. In diesem abgeschlossenen Universum gibt es eine eigene Hierarchie von Experten.
Und wozu brauchen wir dann noch Weiterbildungsinstitute?
Weiterbildungsinhalte verlieren an Bedeutung, da sie schon überall im Netz verfügbar sind. Die Anbieter von Weiterbildung müssen deshalb ein ganz neues Businessmodell entwickeln. Sie sollten Communities begleiten und moderieren anstatt Inhalte zu verkaufen. In Holland gibt es schon einige Anbieter, die sich darauf einstellen – PAT Learning Solutions zum Beispiel. Sie machen sich dafür stark, Menschen zusammenzubringen, die Kenntnisse austauschen wollen. Natürlich verzichten sie dabei nicht ganz auf Inhalte, aber diese rücken in den Hintergrund. Sie entwickeln sich von Content-Bäckern zu Moderatoren.
Als Beirat des Leonardo Awards unterstützen sie das Anliegen, dass Personalentwicklung nicht nur eine fachliche Komponente haben sollte, sondern auch eine persönliche. Gerade in der Managementausbildung macht sich der Preis für mehr soziale Verantwortung stark – zum Beispiel in der Finanzbranche. Inwiefern können neue Tools im Internet dazu beitragen?
Das haben sie schon, einfach indem sie bisher geheime Informationen transparenter machen. So waren etwa Privatkunden früher kaum über die Praktiken von Banken informiert. Heute können sie im Internet verschiedene Angebote vergleichen und erfahren, wo investiert wird. Unternehmen wie die Rabo Bank oder die Triodus Bank, die sich anders positionieren, transparent arbeiten möchten und umweltfreundlich investieren, profitieren davon. Die Betriebe werden mehr Verantwortung für ihre Umwelt übernehmen müssen – und zwar nicht nur in Imagebroschüren. Plumpe PR durchschauen die Menschen heute. Sie sehen über Portale wie Youtube, was Unternehmen in Nigeria oder in Südamerika machen.
Demnach sind die Manager aufgrund zunehmender Transparenz gezwungen, ihr Verhalten zu überdenken?
Mit Sicherheit. Zwar sind viele hochrangige Vertreter oft noch nicht in sozialen Netzwerken vertreten. Die meisten von ihnen sind über 50 und wissen fast nichts von den Möglichkeiten im Internet. Sie nutzen es nur für das, was sie vorher mit Papier gemacht haben, zum Beispiel Briefe verschicken. Aber die jüngere Generation rückt nach und der Druck von außen wächst, sich damit zu beschäftigten. Nehmen wir als Beispiel die Politiker: Wer in der Politik etwas auf sich hält, hat heute seinen eigenen Blog.
Die Niederlande waren das Partnerland des diesjährigen Kongresses Professional Learning Europe (PLE), der parallel zur Zukunft Personal stattfand. Was zeichnet den Markt für Corporate Learning dort im Vergleich zu Deutschland aus?
Zusammen mit Finnland gehört Holland zu den Vorreitern auf diesem Gebiet. Wir hatten auf der PLE einen Vortrag von Philips Lighting. Das ist ein Unternehmen, das gerade eine Universität aufbaut, in der Beschäftigte auf eine solche Art und Weise lernen, wie ich das vorhin beschrieben habe: Sales Manager weltweit bilden sich dort informell und selbstgesteuert weiter – ohne festgelegte Lehrpläne, einfach in Communities. Die Dienstleistungen der Zukunft, die Philips im Bereich Licht leisten möchte, entwickeln die Vertriebsmitarbeiter dabei gemeinsam mit Kunden.
Deutschland kenne ich natürlich nicht so gut, aber ich habe hierzulande einige Lernsysteme gesehen, die noch etwas altmodisch aussehen. Die Firmen benutzen zwar viel E-Learning, aber eher in Form eines elektronischen Buchs. Langsam beginnt zwar ein Umdenken, doch es dauert vermutlich noch ein paar Jahre, bis sich andere Inhalte und Vorgehensweisen etablieren – und ein Personalmanagement, das dazu passt.
Interview: Stefanie Hornung