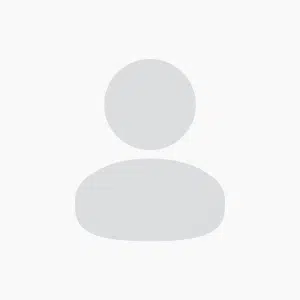Studien zum Teamerfolg

– In ihrer Studie „The romance of teams“ legten Tracey Hecht und Natalie Allen 2010 dar, dass die sozial-emotionalen Vorteile von Teams uns an ihren Erfolg glauben lassen. Die beiden Autorinnen sagten, dass viele, die von Team sprechen in Wahrheit eine Ansammlung von Individuen meinen.
– Googles Project Aristoteles ermittelte 2016, dass psychologische Sicherheit eine wesentliche Säule des Teamerfolgs ist. Danach folgen in absteigender Reihenfolge Zuverlässigkeit, Sinn und der eigene Einfluss und Effekt.
– Verschiedene Studien bescheinigten, dass Reflektivität – nach Luhmann zeitliche, sachliche und soziale Reflexion – ein zentraler Faktor für leistungsfähige Teams ist.
– Ben Kuipers und Marco C. de Witte wiesen nach, dass Teamentwicklung die Leistung steigert, jedoch nicht linear anhand der bekannten Teamphasen von Bruce Tuckmann.
Die Veränderungen in der Arbeitswelt beeinflussen die Teamarbeit. Lebte die alte Arbeitswelt wesentlich von Expertentum und Einzelkult, verlangt die aktuelle immer öfter Innovation und Selbstorganisation. Der einzelne Mitarbeiter kann nicht mehr alles wissen, sondern steuert Puzzlesteine zum Gesamtbild bei. Diese müssen passen und am Ende ein Bild ergeben. Kommunikation innerhalb von Teams und über deren Grenzen hinaus wird zum entscheidenden Faktor. Dabei geht es jedoch nicht um jene Art der Teamfähigkeit, die in Stelleninseraten beschrieben wird, sondern um die Fähigkeit zu Selbstführung, Selbstorganisation und Selbstentwicklung.
Teamarbeit 3.0
Bevor wir einsteigen, sollten Sie sich jedoch fragen, ob Sie wirklich auf ein Team oder auf eine Ansammlung von Individuen schauen, die nebeneinander, aber nicht miteinander arbeiten. Vieles, was Teamarbeit genannt wird, ist keine Kollaboration.
Diese entsteht erst, wenn es um gemeinsame Wertschöpfung geht, um ein Produkt oder eine Dienstleistung, die durch die Zusammenarbeit entsteht und das Zusammenwirken mit allen Konsequenzen verlangt. Das nennen wir Teamarbeit 3.0. Sie unterscheidet sich fundamental von Teamarbeit als soziales Miteinander (1.0) oder der kooperativen Zusammenarbeit in einer Gruppe (2.0), wie sie etwa in zeitbegrenzten Projekten vorherrscht, bei denen das Ergebnis ein Schnittstellenprodukt von Wissen und Erfahrung der Beteiligten ist.
Komplexe Gruppendynamiken bestimmen die Zusammenarbeit. Es sind manchmal Einzelne, die wie „Kitt“ wirken und für Zusammenhalt oder Entwicklung sorgen – und Andere, die das Gefüge sprengen können. Das Unternehmen Google hat in seinem „Project Aristoteles“ ermittelt, was die Charakteristika besonders erfolgreicher Teams (im 3.0-Verständnis) ausmacht. Es waren psychologische Sicherheit, Zuverlässigkeit, Sinn, Struktur sowie der Einfluss des Einzelnen und der Gruppe. Aus dieser Studie sowie einigen anderen (siehe Kasten) – vor allem aber aus der praktischen Arbeit leiten wir folgende Kriterien als maßgeblich ab:
1. Das gemeinsame Ziel
Ein erfolgreiches Team hat ein gemeinsames Ziel. Je stärker die Bindung an ein Ziel ausfällt, desto mehr wird sich das Team dafür ins Zeug legen. Dabei kann es unterschiedliche Blickwinkel auf ein Team innerhalb ein und derselben Gruppe geben. Das heißt, der eine kann sich stark und der andere schwach gebunden fühlen. Je mehr ein Team sich als wertschöpfend begreift, je eher es Einfluss nehmen kann und je sinnvoller auch das Produkt im gesellschaftlichen Sinn ist, desto höher ist die Bindung. Extrinsische Motivation mag für einige wichtig sein, auch Zielerreichung und „Challenge“ kann motivieren, aber am meisten und stärksten engagieren sich Menschen für einen übergeordneten Sinn, der mit anderen Menschen zu tun hat. Niemand hängt sich rein, um das Vermögen des Inhabers zu mehren.
2. Reflektieren Sie Werte
Von hier kommen wir schnell zu den Werten. Werte sind starke Wertungen, die Handlungsimpulse setzen. Sie sagen, wie etwas zu sein hat. Denken Sie über die Werte Ihres Unternehmens und über die Widersprüche nach, die sich daraus ergeben. Legen Sie Werte in einem Workshop niemals fest, denn dann sind es nur Worte, die bestenfalls als Vorlage für das Employer Branding taugen. Werte sind eng mit dem Sinn und damit der Zielbindung verwoben. Sie entwickeln sich oft sehr früh in Menschen und sind deshalb nur bedingt zu beeinflussen. Sie lassen sich weiterentwickeln, brauchen dafür aber emotionale Kopplung. Wenn ein Manager auch emotional versteht, dass Kooperation ein Wert ist, wird er ganz anders auf sein Team schauen als wenn er das nur intellektuell erkennt.
3. Sehen Sie das Team als Prozess
Weiterentwicklung sollte das Credo eines Unternehmens sein, das erfolgreiche Teams etablieren möchte. Das geht nur, wenn sich die Organisation als lernend versteht. Weder Menschen noch Teams sind Fertigprodukte. Es gilt, ihre Entwicklung zu fördern. Das wichtigste Instrument dafür ist Feedback, allerdings liegt darin auch die hohe Kunst, die nur wenige Führungskräfte beherrschen. Es kann bewertend sein, wenn Kriterien klar und eindeutig sind. Es muss konstruktiv sein, damit eine Entwicklungsrichtung sichtbar wird. Vor allem aber muss Feedback aus dem Bewusstsein gegeben werden, dass jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit konstruiert und Rückmeldungen keine Wahrheiten spiegeln, sondern nur die Perspektive des Feedbackgebenden. Eine gute Feedbackkultur legt die Basis für Entwicklung. Auch „negatives“ Feedback, das sich auf Nichterreichen bezieht oder falsche Selbsteinschätzung offenlegt, fördert Entwicklung, sofern es respektvoll und konstruktiv ist.
4. Dressieren Sie nicht, entwickeln Sie
Wer etwas verändern und entwickeln möchte, muss Werte adressieren, da diese das Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Allzu viele Unternehmen fokussieren bei ihrer Personalentwicklung auf Handeln, auf Verhalten also. Sie dressieren damit mehr als dass sie entwickeln. Wer jedoch nach einem eingeimpften, aber nicht gefühlten Wert handelt, ist für andere nie richtig glaubwürdig. Eine nachhaltige Veränderung braucht Zeit, Reflexion und Führungspersönlichkeiten, die neue Orientierungspunkte für die Mitarbeiter setzen, indem sie etwas vorleben.
Wie interagieren wir untereinander und mit anderen? Ein Unternehmen, das sich selbst als lernend begreift, fördert die Kommunikation auf allen Ebenen. Regelmäßige Retrospektiven dienen der Strukturierung und helfen auf der Ebene des Teams, blinde Flecken sichtbar zu machen. Sie übernehmen auch einen Teil der Feedback-Funktionen und fördern so den Reifegrad von Organisation, Team und Mensch.
5. Schaffen Sie Reflexionsräume
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die strukturierte Kommunikation. Dabei geht es nicht um bestimmte Tools und Methoden, sondern um die Qualität der Kommunikation, die durch das Nachdenken über sich und die anderen in der Gruppe sowie ihr Zusammenspiel mit der Organisation auf ein nächstes Level gehoben wird.
Es geht dabei nicht um friedliches und harmonisches Miteinander wie im Team 1.0. Die Herausforderung liegt darin, Menschen zu ermutigen, sich auch konstruktiv streiten zu können. Eine strukturierte und am Prozess orientierte Kommunikation befruchtet das Entstehen von gemeinsamen mentalen Modellen davon, wie Aufgaben erledigt und Ziele erreicht werden.
Retrospektiven aus dem agilem Arbeiten werden leider zu selten für die Metakommunikation genutzt, also das Reden über die Kommunikation miteinander und die Dynamiken in der Gruppe. So bleiben sie an der Oberfläche und werden oft bald gestrichen. Grund sind fehlende Moderationserfahrungen sowie Kenntnisse über psychologische Gruppenprozesse. Die Retrospektive kann ihre Wirkung dann nicht entfalten.
6. Fördern Sie Persönlichkeits- statt Personalentwicklung
Noch bis vor kurzem waren Menschen wesentlich auf Anpassung gepolt. Mitarbeiter sollten ihre Aufgaben erledigen, Fachexpertise einbringen und sich den Umständen unterwerfen. Sie sollten nicht gestalten, Ideen einbringen und sich selbst organisieren. Sie wurden instruiert und angeleitet. Das Lernen war also nicht konstruktivistisch darauf ausgerichtet, dass sich jeder seine Wirklichkeit selbst gestaltet. Der Mensch wurde an eine „ideale“ oder Best-Practice-Wirklichkeit angepasst. Personalentwicklung war vor allem Training.
Die psychologische Konsequenz davon war jedoch, dass die Persönlichkeitsentwicklung auf der Strecke blieb. Der in seiner Persönlichkeit entwickelte, also reife Mensch ist immer ein Mensch mit eigenen Wertmaßstäben und der Fähigkeit, Grenzen zu ziehen. Diese geben ihm erst die Möglichkeit, sich anderen zuzuwenden. Ein reifer Mensch handelt im Einklang mit seinem Denken und Fühlen. Nimmt man die Zahlen der beiden Forscher William R. Torbert und David Rooke, so sind weniger als die Hälfte der Menschen in diesem Sinne reif. Eine Mitarbeiterbindung, die Menschen nicht fesselt, ist aber nur mit freien Persönlichkeiten möglich, die jederzeit die Entscheidung treffen können, zu gehen. Vor diesem Hintergrund ist auch die Persönlichkeitsentwicklung immer auf die Reflexion von Prozessen und Kommunikation ausgerichtet, auf das Was und Wie.
7. Gemeinsame mentale Modelle entwickeln
Das Was (Aufgaben) und das Wie (Vorgehen) müssen klar sein. Was entscheidet das Team, was der Mitarbeiter – und wo will der Chef mitreden? Je mehr Teams darüber sprechen und das klären, desto klarer wird es. Dazu gehören auch gemeinsame mentale Modelle davon, wie Entscheidungen geknüpft werden. Formate wie der konsultative Einzelentscheid sorgen für die Einbindung aller und berücksichtigen zugleich, dass einzelne mehr über ein Thema wissen. Dabei entscheidet das Team, wer die Entscheidung trifft, sich dabei aber mit anderen beraten muss. Alle müssen die sodann getroffene Entscheidung mittragen; sie sind also mitverantwortlich.
Sind gemeinsame mentale Modelle klar, steigt damit die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Zusammenarbeit. Führung von oben wird weniger wichtig. Reife Teams können viele Führungsaufgaben selbst erledigen und sich sogar Ziele selbst setzen. Damit wird Selbstorganisation möglich, die auch unternehmerische Aspekte einbezieht. Manche reifen Teams brauchen irgendwann nur noch jemanden, der sie herausfordert, also Anregungen und Reflexionshilfen von außen gibt. Wer sich Vergleichsmaßstäbe in anderen Unternehmen setzt und Inspiration holt, wird immer neue Ideen für das Quäntchen mehr Leistung finden. Auch die Kreativität wird angekurbelt und spielt über Innovationstätigkeit der Leistung unmittelbar zu.
8. Gemeinsame Identität schaffen
Ein erfolgreiches Team ist wie ein Unternehmen im Unternehmen: es hat eine eigene Identität, ist aber zugleich angebunden, ohne durch Bürokratie in seiner Konzentration gehemmt zu sein. Aber auch wenn es noch nicht so weit ist: Es erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn Teammitglieder sich miteinander identifizieren, wenn ihr Team zum Beispiel einen Namen hat. Zur Identität gehören auch die gemeinsamen Werte (siehe Punkt 2). Dabei dürfen diese sich durchaus von den Unternehmenswerten unterscheiden, solange sie diese nicht unterlaufen. Gerade in größeren Firmen ist es hilfreich, die Werte-Bildung zuzulassen. Da gibt es nun mal die „Innovativen“ oder die „Wilden“, die vieles anders machen. Davon profitiert aber auch das gesamte Unternehmen.
9. Die richtige Teamarchitektur
Die Arbeitswelt hat viele sehr große Teams entstehen lassen. Doch je mehr Mitglieder ein Team hat, desto eher stellt sich Gruppendenken und soziales Faulenzen ein. Neun Teamrollen hat Meredith Belbin einst definiert. Der Antroposoph Robin Dunbar nennt 7 plus/minus 2 als optimal. Kein Zufall, dass diese Zahl der Merkfähigkeit des menschlichen Gehirns entspricht. Wir merken uns 7+/- 2 Dinge – seien es Telefonnummern oder Begriffe.
Dabei sind ungerade Zahlen im Vorteil. Zwischen acht Personen ist es wesentlich schwieriger einen Konsens zu finden als zwischen fünf oder sieben. Es gibt dann einfach kein Zünglein an der Waage. Deshalb funktionieren gerade Zahlen nur in strikt hierarchischen Strukturen, in denen einer eine Ansage macht. 15 Leuten können sich vertrauen und familiäre Strukturen leben. Dennoch ist die Gruppe für effektive Teamarbeit zu groß. Unternehmen sollten daraus mindestens zwei Einheiten bilden, besser vier – sofern es eben um echte Teamarbeit geht oder künftig gehen soll.
10. Teamentwicklung etablieren
Teamentwicklung hilft dabei, psychologische Sicherheit, mentale Modelle, Respekt und eine ergebnisorientierte Haltung entstehen zu lassen. Sie ist auch eine wesentliche Führungsaufgabe in reifen Teams. Da Führungspersonen und auch Personaler jedoch immer auch Teil des Organisationssystems sind, ist es sinnvoll, sich für diese Aufgabe bisweilen externe Hilfe zu holen. In der Diagnose- und Analysephase hilft der Blick von außen, blinde Flecken sichtbar zu machen. Die Prozessbegleitung bekommt dadurch Struktur. Letztendlich ist Teamentwicklung auch die Chance, die Kompetenzen der Teammitglieder, etwa in Moderation, zu fördern.
Teamentwicklung ist ein Prozess, der über Monate und Jahre gehen kann. Der Prozess ist darauf ausgerichtet, die Leistungsfähigkeit zu steigern. Das, was im agilen Kontext oft Agile Coaching genannt wird, ist dabei meist eine Mischung aus Teamcoaching und Teamentwicklung und weniger Coaching im HR-Verständnis.
11. Neue Teams mit Teambildung formen
Teambildung ist ein wesentlicher Baustein im Prozess der Teamentwicklung. In ihm geht es darum, ein neues Team an den Start zu bringen. Das ist auch bei Veränderungen angesagt, etwa wenn neue Mitarbeiter hinzukommen. Vielleicht hat das Unternehmen Einheiten zusammengelegt, vielleicht ein Projektteam neu aufgestellt. Teambildung zielt vor allem auf positive Emotionen und das Entstehen von Vertrauen als Basis für die Zusammenarbeit ab. Das ist neurobiologisch wichtig, denn „gefühlvolle“ Aktionen setzen den Lernprozess in Gang. Ist die Teambildung allerdings nicht in einen längeren Prozess eingebettet, wirken die Aktionen oft nicht lange nach.
12. Bei vorhandenen Teams Dysfunktionen ausräumen
Ein erfolgreiches Team ist ein funktionales. Darin wirken keine starken Dysfunktionen wie fehlendes Vertrauen, mangelnde Konfliktbereitschaft, zu geringes Commitment, fehlende Verantwortungsübernahme oder Status und Ego. Solche Dysfunktionen stellen sich erst nach einer gewissen Zeit der Zusammenarbeit ein und breiten sich besonders gern aus, wenn die Unternehmenskultur kontraproduktiv wirkt, die Führung schwach ist und die Teambildung nicht gut begleitet wurde. In der Praxis erleben wir oft, dass Teams scheitern, weil sie nicht „empowert“ wurden. Rückblicke auf die Zusammenarbeit – Retrospektiven – ermöglichen ein empirisches Vorgehen. Dann lassen sich Hypothesen aufgrund von Erfahrung erstellen und sowohl widerlegen als auch belegen.
Fazit
Was also macht Teams erfolgreich? Zunächst einmal ist es die Möglichkeit, überhaupt zusammenzuarbeiten, was gemeinsame Ziele verlangt. Dann ist es die psychologische Sicherheit und die Möglichkeit, mit dem eigenen Einsatz etwas zu bewirken. Viele Faktoren sind vor allem dadurch beeinflussbar, dass Unternehmen einen Rahmen für gute Teamarbeit schaffen und immer wieder neu ausgestalten. Letztendlich sind Teams aber komplexe Gebilde, die nur bedingt zu beeinflussen sind.