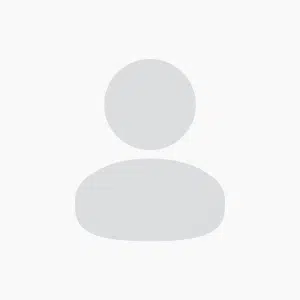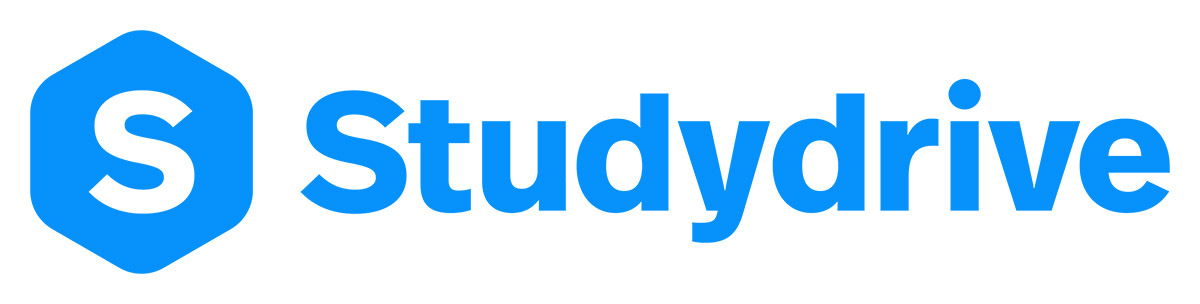Lassen Sie uns nochmal zurück zum Thema „cultural fit“ kommen. Was halten Sie von der These: Egal was jemand fachlich kann, wichtig ist ausschließlich, dass er ins Team passt.

Nienaber: Dem kann ich nicht zustimmen. Nehmen wir einen Sales-Mitarbeiter. Wenn der nicht mit Kunden sprechen kann, hat er keine Berechtigung hier zu sein, auch wenn er noch so gut ins Team passt.
Wahlen: Die richtige Differenzierung ist: „mindset over skillset“. Die Grundkompetenzen müssen natürlich sitzen, etwa komplex Denken zu können, Problemlösungskompetenz, strukturiertes Denken etc. Dazu gibt es auch eine Studie. Indeed hat 1.000 Personalverantwortliche nach den wichtigsten Eigenschaften ihrer Top-Performer in ihren Teams befragt. Die Fähigkeit zu strategischem Denken, Problemlösungskompetenz, das Zeigen von Initiative, Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein waren immer die Antwort.
Leiner: Ich denke auch, cultural fit ist nicht unbedingt der Eingangsschlüssel. Aber es ist auf jeden Fall der Ausgangsschlüssel. In vielen Fällen ist der fehlende fit der Grund für eine Trennung in der Probezeit. Und um das zu vermeiden, muss man am Anfang des Prozesses eben doch auf den cultural fit achten.
Lagemann: In Sachen mindset kann man sehr leicht mit Szenarien arbeiten und Antwortverhalten abfragen. Mit banalen Beispielen kann ich abfragen, wie ein Kandidat tickt, arbeitet und wahrscheinlich im Team agiert. Die fachliche Kompetenz bildet jedoch die Grundlage für ein erstes Gespräch, erst dann wird der Bewerber auf softere Komponenten geprüft.
Wahlen: Vier Komponenten, die idealerweise abgeprüft werden und stimmen müssen, sind: 1. Rollenbasiertes Wissen, 2. Führungsqualität, 3. Fähigkeit zum Durchdenken komplexer Prozesse und schließlich 4. Moral.
Christ: In rechtlicher Hinsicht ist das Auswahlkriterium cultural fit mit Vorsicht zu genießen. Personalleiter sollten daher eher – um auf der sicheren Seite zu sein – auf fachliche Gründe abstellen. Das schließt selbstverständlich nicht aus, gleichzeitig eine mögliche Teamkompatibilität zu überprüfen.
Oft verstreicht die Probezeit ungenutzt und nach sieben Monaten stellt der Arbeitgeber fest, das passt nicht. Wieso wird oft zu lange gewartet?
Leiner: Jeder Vorgesetzte sollte vor Ablauf der sechs Monate automatisiert einen Hinweis bekommen: Entscheide dich! Das ist das Minimum. Ansonsten kann und sollte man natürlich die ersten Monate strukturieren, mit dem neuen Mitarbeiter im Gespräch bleiben. Wichtig ist auch für den Mitarbeiter, dass er regelmäßig bei den Teamkollegen und Schnittstellen nach Feedback fragt. Hilfreich ist auch ein dezidierter Einarbeitungsplan.
Christ: Innerhalb der ersten sechs Monate ist die Sache arbeitsrechtlich relativ einfach. Lässt man die Zeit aber unnötig verstreichen, wird es kompliziert. Ich erhalte als Anwalt in meiner Beratungspraxis immer wieder einmal von Arbeitgebern die Anfrage, wie ein Arbeitsverhältnis„im siebten Monat“ gekündigt werden könne. Das ist aus der Sicht der HR-Praxis ärgerlich. Gibt es bereits innerhalb der ersten Monate Zweifel, müssen die Vorgesetzten Gespräche führen und eine Entscheidung treffen. Viele scheuen aber Problem- und Trennungsgespräche.
Nienaber: Wir machen den Bewerbern einen riesen Hof, führen tolle Gespräche und kümmern uns. Kaum ist er den ersten Tag im Büro, heißt es: Da ist dein Platz, da dein PC. Wo ist die anfängliche Kommunikation geblieben?
Christ: Die Bedeutung der Probe- und Wartezeit wird zukünftig sogar noch deutlich zunehmen. Die neue Regierung macht sich drauf und dran, die sachgrundlosen Befristungsmöglichkeiten weiter einzuschränken. Doch gerade das ist für die meisten Unternehmen neben der Probezeit der zweite Rettungsanker, ein oder zwei Jahre Zeit zu haben, um zu schauen, ob es passt oder nicht. Das ist durchaus legitim zur Erprobung. Bei den Probezeitkündigungen an sich sollte man beachten, dass der Betriebsrat mit im Boot ist und kein Grund im Kündigungsschreiben landet. Sonst bietet man nur eine unnötige Angriffsfläche. Und planen Sie etwas Zeit ein. Bei einer Kündigung auf den letzten Drücker bzw. am letzten Tag der Probezeit passieren häufig Fehler.
Womit lockt man nun die Fachkräfte?
Lagemann: Die Mehrheit der Kandidaten bekommt man durch eine attraktive Vergütung oder vermögenswirksame Leistungen, doch in Zeiten von New Work reicht das nicht mehr aus, die Ansprüche wandeln sich. Individuelle Arbeitszeitmodelle, agile Arbeitsmethoden oder Familienfreundlichkeit sind da wichtige Schlagwörter. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten Anreize zu schaffen. Der Trend geht immer mehr dahin, die Arbeit nach der eigenen Lebenssituation zu richten und nicht anders herum. Daher ist es umso wichtiger, dem Kandidaten ein individuelles – auf seine Lebenssituation zugeschnittenes – Arbeitsmodell zu bieten. Pauschale Lösungen bringen da überhaupt nichts.
Wahlen: Zwei von drei Kandidaten würden sich in Deutschland Angaben zum Gehalt in den Stellenanzeigen wünschen. Das Thema bleibt auf Platz eins. Hinzu treten dann die Wünsche nach flexibleren Arbeitszeiten, Remote Work etc. Aber auch die Wertschätzung und die Frage nach bedeutungsvollen Tätigkeiten rücken in den Vordergrund.
Vielen Dank für das Gespräch! Können Sie abschließend noch ein Fazit für unsere Leser ziehen?
Nienaber: Recruiting schafft sich ab. Maschinen werden die Recruitingprozesse komplett durchziehen. Künstliche Intelligenz wird den Job auch diskriminierungsfrei leisten können.
Lagemann: Die persönliche Aufmerksamkeit wird weiterhin, wenn nicht sogar verstärkt, Wertschätzung beim Bewerber finden. Automatische Verfahren sind zwar sehr hilfreich, der Mensch bleibt aber eine wesentliche Komponente in dem Prozess.
Leiner: Solange soft skills eine Rolle spielen, brauche ich jemanden, der diese auch erkennt. Das ist für mich der Mensch und nicht die Maschine.
Christ: Das Arbeitsrecht als Disziplin wird Antworten auf die Fragen der Digitalisierung des Arbeitslebens geben müssen. Man darf aber nicht vergessen, dass das Arbeitsrecht vor allem das Ergebnis eines politischen und gesellschaftlichen Diskurses ist. Zuerst muss der Gesetzgeber handeln und Vorgaben machen, die dann die Arbeitsrechtler und letztlich die Arbeitsgerichte umsetzen können. Dennoch wartet natürlich keiner darauf, was der Gesetzgeber sagt; die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Der Mensch sollte aber weiterhin das zentrale Element bleiben.
Wahlen: In Deutschland sind wir relativ innovationsschwach, daher glaube ich, dass sich drastische Veränderungen erst in einigen Jahren zeigen werden. Unternehmen müssen die Bewerber mit dem richtigen Content ansprechen und das in einer höheren Geschwindigkeit als bisher sowie über die richtigen Kanäle. Bewerber wollen sich mobil mit einem Klick vorstellen und dabei nicht das Gerät wechseln.
Mit freundlicher Genehmigung der HUSS-MEDIEN GMBH aus AuA 5/18, S. 264ff.
Vor dem eigentlichen Recruiting müssen Arbeitgeber ihre Hausaufgaben machen. Wie wichtig ist Employer Branding?
Lagemann: Ich halte das für ein absolutes „must-have“ in der heutigen Zeit. Viele deutsche Unternehmen hinken dem jedoch immer noch hinterher. Es ist oft schwer zu vermitteln, dass auf allen Ebenen etwas getan werden muss. Ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen stärkt die Außenwirkung als attraktiver Arbeitgeber: Es fängt bei Mitarbeiterempfehlungsprogrammen an und geht hin zu der Frage, wie man mit seinen Beschäftigten umgeht. Statt theoretischer Argumente schafft man eine Unternehmenskultur, die durch Mitarbeiter nach außen getragen wird. Hieraus resultiert eine fundierte und positive Arbeitgebermarke, die anschließend besser weiter vermarktet werden kann.
Leiner: Big Player verwechseln Employer Branding oft mit dem Unternehmensbranding. Sie denken, dass sie da nichts mehr tun müssen, denn sie sind ja schon bekannt. Das ist aber falsch.
Wahlen: Die Menschen suchen schon ganz bewusst nach bestimmten Arbeitgebern. Eine starke Konsumermarke hilft daher schon. Aber Sie haben Recht, es reicht nicht mehr, eine schön gemachte Webseite zu haben und dazu eine coole Kampagne. Es geht um die soziale Komponente, es geht um Bewertungen. Bei den Unternehmensprofilen klicken die Jobsuchenden zu 85 % auf die Bewertungen und nicht auf die Imagevideos etc. Erfolgreiche Arbeitgeber haben nicht in Kampagnen investiert, sondern in tolle Arbeitsbedingungen und ein tolles soziales Umfeld und genau das kommuniziert sich über die Belegschaft von ganz allein über viele Kanäle nach außen.
Nienaber: Ich halte Employer Branding eher noch für einen weiteren Zwischenschritt, dafür müsste man sich mit dem Company Branding beschäftigen. Denn das tolle Employer Branding nützt überhaupt nichts, wenn die Firma selbst nicht funktioniert. Authentizität ist das Stichwort.
Welche Rolle spielt das Talentmanagement?
Leiner: Wenn ich davon ausgehe, dass Talentmanagement bedeutet, jeden einzelnen Mitarbeiter dabei zu unterstützen, seine spezifischen Talente zu entwickeln, dann ist das sehr umfassend und fängt mit dem Recruiting an. Mir muss vorher klar sein, wie groß der Prozentsatz an Mitarbeitern ist, der etwas wegarbeiten soll, und wie groß jener, der sich intern vertikal und horizontal weiterentwickeln kann. Eine Quote von 100 % Weiterentwicklung innerhalb der Belegschaft macht natürlich nur in ganz spezifischen Unternehmenskontexten Sinn. Die Talente, die weiterentwickelt werden sollen und wollen, müssen erstmal erkannt werden. Und dann geht die Entwicklung idealerweise bis zum letzten Arbeitstag weiter.
Was macht der Fachkräftemangel mit der Recruiting-Welt?
Leiner: Ich war Ende der 90er-Jahre auf den ersten Messen, wo bereits der „war for talents“ ausgerufen wurde. So lange schleppen wir nun schon dieses Thema mit uns rum – zumindest in der IT-Branche.
Wahlen: Wir sagen mittlerweile: „war for talent is over – talent has won.“ Die Situation hat sich natürlich dramatisch verschärft. Es gibt nicht mehr den Fachkräftemangel, sondern schlicht einen Arbeitskräftemangel. An Zahlen festgemacht: Mehr als ein Viertel der Stellen deutschlandweit bleiben mehr als 60 bis 90 Tage unbesetzt, verbleiben also auf den Recruiting-Portalen. Und so verändert sich das Machtverhältnis. Es geht mehr um Kandidatengewinnung als um Kandidatenauswahl.
Nienaber: Hier möchte ich noch den demografischen Wandel ins Spiel bringen. Dieses Thema ist nun wirklich hoffentlich bei jedem angekommen. Jetzt haben wir den Mangel, vor allem in den Blue-Collar-Berufen, und das ist schon dramatisch, denn Deutschland ist (noch) ein Produktionsland. Ebenso im Pflegebereich: Hier fehlen uns rund 350.000 Kräfte in den kommenden Jahren. Gleichzeitig schmoren viele Recruiter im eigenen Saft. Viele kennen nur Xing und Jobbörsen als Kanal und dann wird‘s dünn. Über Ländergrenzen hinweg wird auch kaum gesucht. Hierzu ein schönes Beispiel: Eine IT-Firma an der tschechischen Grenze, die ich beraten habe, rekrutiert deutschlandweit aber eben nicht im Nachbarland. Auf diese eigentlich nahliegende Idee sind sie einfach nicht gekommen.
Lagemann: Ich beobachte derzeit in Unternehmen, dass wir es schaffen, Leute aus dem Silicon Valley nach Berlin zu holen. Das Leben ist hier nicht nur günstiger als in Kalifornien, die Mitarbeiter bekommen abseits der Arbeit auch viel mehr geboten. Aber das ist nur ein Beispiel. Die Internationalisierung setzt in der Recruiter-Welt noch viel zu langsam ein. Denn Personal kann auch gerne mal woanders herkommen, aus den USA, Tschechien etc. Wir leben in einer vernetzten Welt und sollten dieses Potenzial auch nutzen.
Wahlen: Berlin ist übrigens auch aus Datensicht ganz spannend. Die Hauptstadt ist die sechstbeliebteste Stadt weltweit, was Jobsuchen betrifft und Deutschland steht im Ländervergleich auf Platz vier. Davor liegen nur die englischsprachigen Länder USA, Kanada und England. Berlin hat die kürzeste Stellenbesetzungszeit. Das liegt zum einen daran, dass hier rund 600.000 Ausländer leben, die überwiegend sehr qualifiziert sind, und dann daran, dass die Unternehmen hier offener sind. Sie passen ihre Anforderungen den Gegebenheiten an und sind so erfolgreich in der Besetzung von Vakanzen. Einige Unternehmen in Deutschland werden austrocknen, wenn sie nicht anfangen, sich für die neuen Märkte und für andere Bewerber zu öffnen, gerade außerhalb der Ballungsgebiete. Arbeitgeber müssen lernen, dass sie ihre Unternehmenssprache anpassen. Nur mit Englisch kommt man weiter. Wie sonst sollen die neuen Mitarbeiter auch integriert werden?
Leiner: Die Entscheidungsträger sind meist schon seit Längerem in Verantwortung und die nehmen das Problem nicht richtig ernst, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Trendvorhersagen nicht immer Wirklichkeit werden. Jetzt ist es aber keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität. Es gibt bereits eine Parallelwelt. Der Umgang miteinander ist anders geworden, die Ansprache von Bewerbern etc. Die Arbeitsplätze verändern sich entsprechend, werden mobil und flexibel, neue Teams bilden sich und lösen sich wieder auf, Hierarchien werden infrage gestellt. Innovation bekommt eine viel größere Bedeutung. Ich empfehle jedem Entscheidungsträger, einmal in die New Work-Welt einzutauchen und sich darauf einzulassen. Sie bekommen das sonst nicht mit und hören den Schuss nicht.
Nienaber: Und noch etwas hat sich verändert: Die Arbeitnehmer müssen gar nicht mehr umziehen für den Job. Sie können weiter in Kapstadt (gleiche Zeitzone!) oder Mombasa tätig sein – zumindest wenn es um Wissensarbeiter geht. Wir müssen die Menschen nicht in die Großstadtsilos bringen, wir brauchen sie hier nur beauftragen. Warum muss mein Kollege zwingend neben mir sitzen? Der technische Fortschritt gibt uns doch die Mittel in die Hand, das zu ändern. Fraglich ist ja auch, ob wirklich jeder zu uns ins kalte und ausländerfeindliche Deutschland will.
Wahlen: Und nochmal ein paar Zahlen zum Thema Bedürfnis der Kandidaten: Bei Elektronikern ist das Verhältnis Bewerber vs. angebotene Stellen 1:3. Bei Softwareingenieuren ist es teilweise 1:7. Bei Teilzeit oder „Working from home“ hingegen beobachten wir das umgekehrte Phänomen: Hier ist das Verhältnis Stellengesuche vs. offene Stellen 10:1. Es gibt ein riesiges Interesse, das nicht auf entsprechende Angebote trifft. Der Arbeitsmarkt öffnet sich zu wenig den Bedürfnissen der Menschen.
Christ: Zunächst ist es natürlich eine Kulturfrage im Unternehmen, wie ich mit dem Bedürfnis nach mehr Flexibilität und mobiler Arbeit umgehe. Arbeitgebern ist bewusst, dass sie mit solchen Angeboten punkten müssen, wenn ihr Sitz auf der grünen Wiese ist. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht immer einfach aber durchaus zu handhaben. Das ArbZG ist ein in die Jahre gekommenes Gesetz – es besteht hier dringender Handlungsbedarf. Die Mitarbeiter wollen heute von verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten arbeiten. Die Stechuhr hat ausgedient. Die Arbeitszeit zu kontrollieren, ist aufwendig und kontraproduktiv. Einer der großen Knackpunkte ist, dass der Gesetzgeber z.B. eine elfstündige Ruhepause zwischen Arbeitsende und -beginn vorschreibt. Das geht an der Realität komplett vorbei. Viele checken abends noch einmal ihre E-Mails oder beantworten schnell eine einfache Anfrage. Vielleicht leitet jemand auch nur eine Nachricht weiter. Wenn man es genau nimmt, ist das dann schon Arbeit und die Uhr läuft von vorn. Eine elfstündige Unterbrechung kann kaum eingehalten werden. Zudem kommen viele Fachkräfte gar nicht erst ins Unternehmen, wenn ihnen eine solche Arbeitsweise verboten wird. Manch Arbeitnehmer will bspw. vier Stunden arbeiten, sein Kind aus der Kita holen, wieder arbeiten und nach dem Abendbrot noch einmal zwei Stunden E-Mails beantworten. Rechtlich bewegt man sich da als Unternehmen schnell in einer Grauzone.
Wie läuft die richtige Ansprache der Kandidaten – Wo hole ich meine Bewerber heute ganz konkret ab?
Nienaber: Man muss tatsächlich dort sein, wo die Zielgruppe ist. Und hier ist nicht nur der Recruiter gefragt, sondern die Fachabteilung. Der ganze Druck wird beim Recruiter abgeladen, dabei müsste es umgekehrt sein, denn die Fachabteilungen sind die Abnehmer, die müssten viel mehr in Erscheinung treten und Initiative zeigen. Wenn ich die Fachabteilungen frage, in wie vielen Gruppen seid ihr denn aktiv und wie oft postet ihr dort, bekomme ich meist Schulterzucken als Antwort. Stellenanzeigen werden meist gar nicht weitergeleitet. Das verstehe ich nicht. Ich meine auch nicht zwangsläufig die klassischen Jobportale, ich meine vor allem auch die Fachforen und Gruppen, wo sich über Entwicklungen und Produkte ausgetauscht wird.
Leiner: Ich sehe da auch die Führungskraft selbst in der Pflicht. Diese muss sich extern sichtbar machen. Klar, das benötigt Zeit, aber nur so bekommt sie ein Gespür dafür, was gerade die Trends am Markt sind.
Lagemann: In keinem Anforderungsprofil für Führungskräfte ist hinterlegt, dass nicht nur Personalführung und Talentmanagement, sondern auch die Nachbesetzung von Stellen ureigene und wahrzunehmende Aufgabe des Managers selbst ist.
Nienaber: Vielen Führungskräften fehlen die Skills. Sie sind oftmals aus fachlichen Gründen zur Führungskraft gemacht worden. Führen und Rekrutieren können sie schlicht nicht. Letztlich ist das aber eine Aufgabe für drei Personen: den Recruiter, die Führungskraft und den derzeitigen Stelleninhaber, denn der weiß am allerbesten, welche Anforderungen ein neuer Kandidat erfüllen muss. Zudem hat der ein Netzwerk, das er ansprechen kann. Deshalb müssen alle drei zusammen die Stelle besetzen.
Wahlen: Ganz genau. Der letzte Punkt ist für mich entscheidend und der nennt sich Reichweite. Der größte Mythos ist, dass Kandidaten nicht aktiv suchen. Fakt ist aber: 91 % der Bewerber, die neu eingestellt werden, haben vorher aktiv nach einem Job gesucht. Und genau deshalb muss über alle Kanäle geworben werden. Es reicht nicht, die Stellenanzeige bei sich auf die Homepage zu stellen. Wir müssen uns vor Augen führen, dass der Moment der Erstansprache unfassbar kurz ist. Die ersten fünf bis sieben Sekunden sind entscheidend. Dementsprechend wichtig ist die Einleitung. Übrigens: Ab 30 Fragen springt die Hälfte aller Bewerber bei einem Auswahlprozess ab. Machen Sie es nicht so kompliziert! Je länger und intransparenter der Prozess ist, desto schwieriger wird es. Manche Firmen wollen zunächst nur die E-Mail-Adresse und Google bspw. genügt der Lebenslauf.
Leiner: Man sollte übrigens Fachmessen nicht unterschätzen. Ich meine nicht Jobmessen! Hierher kann man mit einem Recruiter gehen. Unternehmen müssen sich vernetzen, nicht nur untereinander, sondern auch mit den Fachkräften. Dann kann man ganz gezielt eigene Scouts mitnehmen, die andere begeistern können für den Betrieb.
Christ: Hier muss man natürlich vorsichtig sein. Insbesondere beim Abwerben von Arbeitnehmern aus festen Arbeitsverhältnissen stellt sich die Frage nach den rechtlichen Grenzen. Das fängt schon bei der Zusendung eines Jobangebots ohne vorherigen Kontakt an: Woher habe ich die Informationen über den entsprechenden Kandidaten, durfte ich diese verarbeiten und liegt hierzu eine Einwilligung vor?
Nienaber: Aber passiert das nicht täglich auf Xing?
Christ: Solche berufsbezogenen Portale sind rechtlich eher unproblematisch. Xing bspw. wird als Jobplattform verstanden. Wer hier unterwegs ist, hat wohl grundsätzlich nichts gegen entsprechende Anfragen oder hat auf dem Portal eine Zustimmung zur Zusendung von Job-Angeboten erteilt. Bei Facebook hingegen würde ich einem Recruiter davon abraten, eine Kaltakquise durchzuführen. Facebook stellt im Unterschied zu Xing oder Linkedin keine Recruting-Webseite dar. Bereits das Identifizieren und die Herstellung des Kontakts basieren auf einer Datennutzung. Der Bewerber könnte einwenden, hierzu keine Einwilligung gegeben zu haben. Man darf insbesondere nicht vergessen, dass sich jetzt im Mai mit dem neuen Datenschutzrecht einiges gravierend ändern wird. Vorgänge müssen sauber laufen und rechtlich geprüft werden. Das war zwar bisher so und das wird auch so bleiben. Der Unterschied liegt nun aber vor allem in den Sanktionsmöglichkeiten. Es drohen bei Verstößen enorme Bußgelder. Und hier könnten interne Compliance-Vorschriften auch die HR-Prozesse lähmen, weil aus Vorsicht nicht gehandelt wird oder neue Pfade wieder verlassen werden.
Lassen Sie uns über die Generationen sprechen. Gibt es überhaupt noch einen gemeinsamen Nenner?
Leiner: Ich will darauf mit den Sinus-Welten antworten. Hier werden Gruppen gleichgesinnter Menschen gebildet. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, in welchem Alter sich jemand befindet, ob er Generation Y oder Z ist. Da geht es um Ansichten bzw. Lebenseinstellungen und die Frage, ob diese dann im Berufsalltag zusammenpassen. Ein paar Beispiele: Welche Zielgruppe wünscht sich Selbstverwirklichung im Beruf? Das sind die Expeditiven und die experimentalistischen Hedonisten. Wer sucht danach, dass der Beruf den eigenen Neigungen und Fähigkeiten entspricht? Das sind eher die Sozialökologischen. Wer meint, dass es im Beruf Karrierechancen geben müsste? Das ist der Adaptiv-Pragmatische. Wer geht auf das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein? Das ist der Bürgerlich-Konservative mit Neigung zum sozial-ökologischen. Wer sucht das hohe Einkommen? Das sind die materialistischen Hedonisten und die Prekären suchen Krisensicherheit. Was passiert nun, wenn sich alle Unternehmen – und den Eindruck habe ich derzeit – auf die expeditiven Querdenker stürzen, obwohl sie diese Art Mensch in ihrer Organisation überhaupt nicht gebrauchen können? Arbeitgeber müssen wissen, wie die Menschen, die für sie arbeiten, strukturiert sind. Nur wenn die Mischung stimmt, fühlen sich die Beschäftigten wohl. Und das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen für das Recruiting selbst und die Frage, auf welchem Kanal ich suche. Pragmatisch-Adaptive finde ich auf Karriereseiten, die Bürgerlich-Konservativen eher auf Seiten, die sich mit Familie und Beruf befassen. Und entsprechend nach meinen Suchanforderungen würde ich den Inhalt meiner Stellenanzeigen bzw. die Selbstvermarktung meines Unternehmens darauf ausrichten. Ich bin überzeugt davon, dass man Menschen mit etwa vier gezielten Fragen relativ schnell in ein bestimmtes Milieu/Sinuswolke einordnen kann.
Wie geht man die konkrete Bewerberauswahl an?
Nienaber: Assessment-Center nutzen bspw. eher die großen Firmen. Zeitlich und technisch steckt hier ein sehr hoher Aufwand dahinter. Aber ganz wesentlich ist aus meiner Sicht der Zeitfaktor. Nehmen wir etwa die Dauer bis zu einer Zusage für die Stelle, da steht Deutschland im letzten Drittel. Es dauert einfach alles viel zu lange. Und da sind die guten Kandidaten weg. Ziel müsste eigentlich sein, Kandidaten spätestens innerhalb von 24 Stunden die Zu- oder Absage zumindest zum persönlichen Kennenlernen zu geben. 24 Stunden – und nicht 24 Tage – denn da befinden wir uns derzeit!
Leiner: Ja, aber! Die Frage ist doch, soll der Recruiter möglichst schnell ein Ergebnis präsentieren oder soll schnell jemand an Bord sein, der zeitnah performen kann. Und um eine Aussage zur potenziellen Performance machen zu können, muss ich z.B. Testverfahren einsetzen.
Nienaber: Das ist doch kein Widerspruch. Ich kann innerhalb von 24 Stunden einen Kandidaten komplett screenen und sämtliche Assessments online durchziehen. Ich kann die Fachabteilung hinzuziehen und Videointerviews machen sowie die Abschlussbewertung mit allen Beteiligten vornehmen. Wenn ich Prozesse verändere, bekomme ich das auch hin.
Leiner: Ob man damit dann bei der Qualität Abstriche machen muss, vermag ich nicht zu beurteilen – Stichwort: Wahrnehmungsfehler bei Videointerviews. Einigen wir uns darauf, dass in bestimmten Positionen mit einfachen Tätigkeiten auch die Anforderungen an das Auswahlverfahren gesenkt werden können.
Wahlen: Ich würde auch an diesem Punkt gerne nochmal auf das Thema Zeit zurückkommen. Nach der Zusage zum persönlichen Gespräch sagen Führungskräfte häufig die Termine wieder ab, weil sie andere Dinge priorisieren und so nimmt dann die Wartezeit zum Gespräch ungefähr 70 % der Gesamtzeit des Bewerbungsprozesses in Anspruch. Insofern ist das Ziel von 24 Stunden nicht wirklich realistisch, aber die zeitige Rückmeldung sollten Unternehmen angehen. Derzeit wartet ein Bewerber in Deutschland durchschnittlich acht Tage auf eine erste Antwort vom Unternehmen.
Christ: Da stellt sich mir die Frage, warum automatisiert man nicht gleich den ganzen Rekrutierungsprozess? Dann trifft der Computer und nicht die Personalleitung anhand der vom Bewerber abgefragten Daten die Einstellungsentscheidung, und das schnell und vor allem nachweisbar diskriminierungsfrei. Allerdings steht man dann schnell vor einem Folgeproblem – nämlich, ob diese Vollautomatisierung rechtlich noch zulässig ist, da dann die Persönlichkeitsrechte des Bewerbers zu sehr vernachlässigt werden.
Leiner: Das größte Bedürfnis, was Menschen haben, ist das Bedürfnis nach Wertschätzung und in ihrer ganzen Individualität erkannt zu werden. Gerade die jungen Leute sind extrem auf Beziehung orientiert. Am meisten schätzen sie den Arbeitgeber, der sich mit ihnen als Persönlichkeit auseinandersetzt – und dazu gehört: Ich gucke dir in die Augen, nicke dir verständnisvoll zu, setze dich nicht unter Druck, plaudere vielleicht auch ein wenig privat. Und deshalb wird sich die Vollautomatisierung in diesem Bereich nicht durchsetzen, auch wenn es kostengünstig ist und extrem viel Zeit spart. Und so, wie ich mich dem Bewerber am Anfang präsentiere, so muss der Mitarbeiter auch am ersten Arbeitstag, im dritten und fünften Jahr die Unternehmenskultur erleben. Wenn da ein Bruch ist, habe ich meinen neuen Beschäftigten ganz schnell verloren.
Wahlen: In den USA gibt es viele Firmen, die Bots (Antwort-Roboter) benutzen, um auf Bewerbungen zu antworten. Die Bewerber antworten mittlerweile aber auch mit Bots. Das heißt, die Konversation findet bereits zwischen Maschinen statt. Ich glaube schon, dass es viele Prozesse geben wird, die das Bewerbungsverfahren insgesamt automatisieren. Die menschliche Komponente bleibt aber weiter ein entscheidender Faktor.
Das Ganze klingt nach Recruiting 4.0.
Nienaber: Ganz genau, wir reden über Mensch vs. Maschine und Maschine vs. Maschine. Und das Thema Bots zeigt ja schon, dass die Wertschätzung auf der Bewerberseite eine ganz andere geworden ist. Ich sehe nicht, dass man in Zukunft großartig lange Telefonate führen muss, um sich kennenzulernen. Und das bedeutet aus meiner Sicht keine Einbuße in Sachen Qualität.