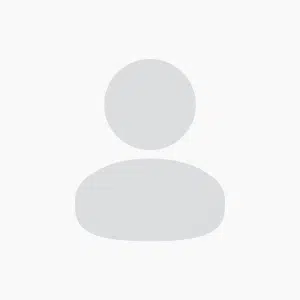Für eine Analyse des Scheiterns sind also zunächst die Umstände von außen wichtig. Aber Scheitern kann ja auch von innen kommen.
Ja, das ist völlig richtig. Ich habe das Sitzenbleiben in der Schule immer zu einem großen Teil auf mich selber bezogen. Ich bin zweimal hängengeblieben in der Schule. In dem Jahr als mein Vater starb, blieben auch meine beiden Geschwister sitzen – das kann man dann auch mit den Umständen erklären. Beim ersten Mal war es aber einfach Faulheit, Dummheit, Enthusiasmus für alles andere außer für den Schulunterricht. Und insofern muss man sich das schon selber anrechnen.
Als ich dann als großgewachsener Konfirmand zwischen lauter jüngeren Mädchen saß, fühlte sich das regelrecht wie ein Versagen an – das war nicht besonders sexy.
In Ihrem Buch „Der Knacks“ unterscheiden Sie verschiedene Formen des Scheiterns – zum einen die Lebensbrüche und zum anderen den Knacks. Was macht diesen Unterschied aus?
Ich kann es an zwei Symbolen klarmachen. Das eine wäre die Narbe: ein Scheitern, bei dem ich mich immer an den Tag erinnere – zum Beispiel an den Tag, an dem ich das Zeugnis bekam mit dem Hinweis, Roger Willemsen wird nicht versetzt. Zu diesem Zeitpunkt erfahre ich von meinem Scheitern oder ich kriege das Dokument dafür. Das wird mir wehtun und das ist über diese Narbe immer erinnerbar. Das andere wäre die Falte, die sich irgendwann in die Haut einprägt, die irgendetwas verrät, die eine Form von Ermüdung, Bitterkeit oder Enttäuschung haben kann. Sie vertieft sich ganz leise, sie ist an einem Tag nicht dagewesen, aber sie wird immer markanter und prägender und zeichnet irgendwann das Gesicht. Sie hat eine Geschichte. Sie ist wie eine Krakelee, wie die Rissglasur, die manche alten Vasen haben, die sie eigentlich erst ausmachen. Es ist etwas, was in schleichenden Prozessen kommt.
Und viele der Prozesse, die durch dieses „irgendwann irgendwo irgendwas“ bestimmt sind, werden von uns nicht identifiziert. Wir denken eher bürokratisch. Wann bin ich eingeschult worden, wann bin ich hängengeblieben, wann habe ich geheiratet, wann habe ich die ärztliche Diagnose bekommen? Wir orientieren uns an diesen Einzeldaten, doch wenn wir uns erinnern, besteht unser Leben immer aus namenlosen Prozessen, von denen wir häufig gar nicht wissen, wann haben sie angefangen und seit wann sind sie abgeschlossen. Das Essen schmeckt nicht mehr, Küsse sind nicht mehr, wie sie einmal waren, der Wald wirkt nicht mehr so, wie er früher auf mich wirkte. Die Vergnügungen sind ausgeschöpft. Wann hat das eigentlich begonnen? Wenn man sich mit dem Scheitern beschäftigt, muss man eigentlich immer beide Prozesse beachten: Wie ein Mensch zusammengesetzt wird aus den Einzelsituationen der Niederlage und aus den großen Prozessen.
Ein typischer Knacks wäre dann sozusagen, wenn Menschen am Arbeitsplatz ausgebrannt sind und die Freude an der Arbeit verloren haben.
Ja, ganz recht. Dann reicht es eben nicht aus zu sagen, der hat den Zuschlag nicht bekommen, dessen Kollege ist an ihm vorbei befördert worden. Das sind immer bloß Anlässe. Aber gerade in der Arbeitswelt muss man diese heimlichen, schleichenden Prozesse ebenfalls mitbetrachten. Doch das geschieht nur selten.
Warum halten Sie das gerade in der Arbeitswelt für wichtig?
Wo Unternehmen allein das Leistungsprinzip verfechten, bringen sie ihre Mitarbeiter an die Grenzen der Belastbarkeit. Deshalb sind Phänomene wie Burnout, Leistungsfunktionsstörungen, Depressionen, Erschöpfungssyndrome die Krankheiten der Zeit. Das hat nicht nur mit der reinen Arbeitsüberforderung zu tun, sondern auch mit der Entfremdung. Dass Menschen ihre Arbeitsabläufe gar nicht mehr überblicken, sich nur noch wie eine riesige funktionierende Einheit in einem großen Komplex erleben. Sie sehen weder, wo sie herkommen noch wo sie hingehen. Wo der Mensch selbst maschinenförmig wird und die Effizienz einer Maschine haben soll, jederzeit leistungsfähig, ohne Reibung, ohne Störung, da kommt er an seine Grenzen.
„Wo der Mensch selbst maschinenförmig wird
und die Effizienz einer Maschine haben soll,
jederzeit leistungsfähig, ohne Reibung, ohne Störung,
da kommt er an seine Grenzen.“
Deshalb bleibt den Unternehmen nichts anderes übrig als eine so irrationale Seite wie das Scheitern einzubeziehen. Und auch so etwas wie Motivation, Begeisterung, Identifikation – alle diese Dinge, die letztlich im immateriellen Bereich der Kultur liegen. Lange hat man gedacht, man könne das alles materiell lösen. Aber das geht nicht mehr mit Bonusregelungen oder mit Entschädigungszahlungen für ausfallende Wochenenden.
Was müsste sich in den Unternehmen ändern?
Mitarbeiter sollten eine ganzheitliche Sicht auf das bekommen, was ein Unternehmen macht. Sie brauchen eine gewisse Durchsichtigkeit der Abhängigkeiten und des Ineinandergreifen von Arbeitsprozessen. Ich habe selber einmal eine Fernsehproduktionsfirma gehabt und als wir noch richtige Fernsehshows machten, da durften die Redakteure immer alles machen. Wenn wir einen Gast hatten, dann kümmerte sich eine Person um die Akquise, die Vorbereitung, die Abholung vom Flughafen und die Betreuung auf dem Set. Und das hat bei den Redakteuren immer dazu geführt, dass sie sich mit großem Enthusiasmus auf die Arbeit gestürzt haben, weil sie wussten, ich bin für alles verantwortlich. Diese Ganzheitlichkeit verhindert, dass jemand nur stur seine Arbeit tut und keine Beziehung mehr zum Rest hat.
Wenn man insgesamt auf das Berufsleben schaut: Die Lebenserwartung der Menschen steigt. Zukünftig werden wir wohl bis zum 70. Lebensjahr und darüber hinaus arbeiten müssen. Wie schaffen wir es angesichts von Lebensbrüchen und Knacksen, dass wir so lange durchhalten?
Wir brauchen ein klares Gegengewicht zur reinen Arbeit. Da komme ich wieder auf das Prinzip des qualifizierten Lebens zurück. Es braucht immer wieder Erlebnisse, die Erfahrungen verdichten – mithilfe von Kultur, Literatur, Musik oder dem Film. Man braucht die Fähigkeit, sich zu transzendieren, also in irgendeiner Weise sich zu überschreiten und sich von oben anzuschauen, was man ist und was man tut, statt es ausschließlich zu absolvieren. Wenn wir schon so viel Zeit mit der Arbeit verbringen, ist es wichtig, ihr auch Sinn zu geben.
Interview: Stefanie Hornung
Herr Willemsen, früher wurden Kinder und Jugendliche oft gefragt, was sie einmal werden wollen – und damit war der Beruf gemeint.
Inwiefern ist diese Vorstellung von einer Art Masterplan mit einem klaren beruflichen Ziel noch zeitgemäß?
In meiner Jugend hat man sich mit etwas Courage durchgerungen, seiner eigenen Leidenschaft zu folgen und zu sagen, „komme was da wolle, wenn ich glaube, Schriftsteller werden zu müssen, dann werde ich mich irgendwie auf dem Weg durchsetzen“. Man war gewissermaßen von der Notwendigkeit, einen Beruf mit Enthusiasmus ausfüllen zu können, überzeugt.
Dann kommen pragmatischere Zeiten, in denen wir sehr viele BWL- und Jura-Studenten sehen, die sich – vor allen Dingen angesichts der hohen Arbeitslosigkeit – plötzlich stärker Gedanken über ihr soziales Auskommen machen.
Und heute ist die Idee des akademischen Proletariats, der Selbstausbeutung und der ökonomischen Probleme in Wissensberufen, so verbreitet, dass junge Menschen nur noch irgendwo unterkommen wollen. Meine Studenten sagen, „ich möchte irgendwie mit Literatur arbeiten dürfen, irgendetwas im Internet machen oder etwas, das mit Grafik zu tun hat“. Das Berufsbild ist diffuser geworden.
Früher arbeiteten die Menschen oft ein Leben lang für einen Arbeitgeber.
Heute ist das anders.
Wie wandelt sich vor diesem Hintergrund das Bild von Erfolg im Beruf?
Lange Zeit hieß Erfolg, dass man sich mit einem Unternehmen so stark identifiziert, dass man sich gegen Ende des Lebens einen hohen Respekt erworben hat, gut bezahlt wurde und sich gewissermaßen als Gesicht der Firma fühlte. Die Firma war etwas, was einem nützt und dem eigenen Charisma dient. Dann gibt es das Berufsbild dessen, der seinen beruflichen Erfolg eher durch einen sozialen Aufstieg bestimmt. Und bei einer Generation wie der meinen, bei der eigentlich alle Kinder reicher geworden sind als ihre Eltern, war die Aufstiegsidee fast eine Parallele zum Wirtschaftswunder. Alle sagten, ohne Haus will ich aber nicht.
Inzwischen werden viele mehr erben als sie selber verdienen. Gleichzeitig hat sich die Idee des Erfolgs vom rein Materiellen wegbewegt. Die nicht-scheiternde Familie verzeichnen heute viele Leute als Erfolg. Das bedeutet eine Hinwendung zur Erfüllung, zur Vorstellung, dass man mit der eigenen Arbeit etwas Sinnvolles, sogar Gutes tut. Damit ist der Erfolg stärker qualifiziert statt quantifiziert.
Wie spielt das Scheitern in den Erfolg mit hinein?
Wir haben lange Zeit all das verdrängt, was Misserfolg, Scheitern, Lebensbruch angeht und aus dem linearen Prinzip des Karrierismus ausscherte. Doch es sind die Zeiten gekommen, in denen wir festgestellt haben, dass das Erfahren und Überwinden einer Niederlage zum Bauprinzip einer geglückten Arbeitsbiographie gehören kann. Das gilt auch für das Privatleben. Wer beruflich oder privat Scheitern kennenlernt, wird plötzlich ein Mensch mit anderer Grundierung. Das stattet uns mit einer anderen Form von Empathie aus für die, die unter Umständen an ihre Leistungsgrenzen kommen. Das Scheitern schärft auch den Blick für Talente und Begabungen.
Scheitern beginnt oft schon am Anfang des Berufsweges. Die Zahl der Studienabbrecher wird jährlich auf 100.000 geschätzt.
Und viele junge Leute werfen ihre Ausbildung hin.
Was sehen Sie da für Gründe?
Bei meinen Studenten beobachte ich mit Schrecken eine Reihe psychosomatischer Erkrankungen, Depressionen und Panikzustände, die sich in einer geringen Konzentrationsspanne und einer frühzeitigen Antriebslosigkeit niederschlagen. Da ist ein starkes Phlegma – nicht unbedingt dem Gegenstand gegenüber, sondern dem gesamten Leben gegenüber.
Zum Teil ist das sicher darin begründet, dass ein berufliches Motivationsloch besteht. Von meinen allerbesten Studenten und Studentinnen hat im Moment keiner eine Stelle auf Höhe der eigenen Begabung.
Was empfehlen Sie jemand in so einer Sinn- oder Motivationskrise:
Eher durchbeißen oder hinwerfen?
Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Manchen Studenten fällt es schwer herauszufinden, was ihre reale Leidenschaft ist und worüber sie ihre Abschlussarbeit schreiben sollen. Dann versuche ich das durch Ausschlussfragen zu isolieren. Sie wissen nicht, welche Epoche. Dann sage ich, schließen wir mal Epochen aus. Dann kommt man meistens beim Genre an. Sie wollen aber nicht über Lyrik schreiben? Nein. Auch nicht über Dramatik? Nein. Dann wollen Sie über den Roman schreiben? Ja, über den Roman. Und dann geht das so weiter nach einem K.-o.-System.
Der andere Aspekt ist, dass man auch mal fragt: „Seid Ihr sicher, dass das die richtige Arbeit für Euch ist? Wie seid Ihr gerade auf das Fach gekommen? Wisst Ihr was hier auf Euch zukommt?“ Es passiert aber sehr häufig, dass die Leute fehlende Begabung lieber nicht ehrlich ansprechen.
Eine fehlende Begabung oder die falsche Berufswahl – wir tun uns ja auch oft schwer damit, uns unsere Niederlagen einzugestehen.
Ja, das sehen Sie zum Beispiel daran, dass Niederlagen eine ewige Quelle des Humors sind. Man macht die allerbesten Witze, indem man sich über sich selber lustig macht und Selbstironie demonstriert, wenn man erzählt, was alles schief gelaufen ist. Es gibt kaum ein Gebiet im Leben, in dem man aus dem Misslingen nicht eine Pointe gewinnen kann.
„Es gibt kaum ein Gebiet im Leben,
in dem man aus dem Misslingen nicht eine Pointe gewinnen kann.“
Oft vergessen wir darüber die Bedingungen und Gründe dieses Scheiterns und fragen uns nicht, worin wir unser eigenes Scheitern verschulden oder verursachen. Diese Analyse ist wichtig. Daniel Goeudevert, ehemals VW- und Ford-Manager, wollte nach seinem Ausscheiden aus der Wirtschaft einen Lehrstuhl aufmachen, der Managern erklärt, auf welche Weise das Scheitern in ihr Leben kommt und was passiert, wenn man gescheitert ist. Wie ändert sich die Tonlage der Kollegen, wie viel Kompetenz habe ich noch, wenn man mir alles das wegnimmt, was mit meinem Status zusammenhängt? Er sagte damals, ich wusste nicht mal wie viel Porto man auf einen Brief draufkleben muss. Diese Lebensuntauglichkeit, die der Misserfolg einem klarmacht, kann man frühzeitig verhindern. Goeudevert hat das so gelöst, dass er immer einen Tag im Monat am Fließband stand und sich in die normalen Arbeitsabläufe begeben hat.
Wann sind Sie denn einmal gescheitert?
Ich bin vielfach gescheitert und zwar früh. Auf der einen Seite nehme ich den Tod meines Vaters als Scheitern wahr. Das ist zwar irrational, aber es ist so. Auch deshalb, weil ich ein sehr schlechter Schüler war, als mein Vater starb und mir das nie verziehen habe, dass mein Vater in einer Situation gestorben ist, in der ich sitzengeblieben bin und wirke wie ein wirklicher Fehlgriff. Er war überzeugt, ich lande an der Tankstelle – und ich war es auch. Die zweijährige Sterbenszeit und die ganzen Umstände, das waren äußere Faktoren, die dazu führten, dass vieles, woran ich reifte, zu der Zeit nicht gerade in der Schule stattfand.
Über Roger Willemsen
Roger Willemsen, 1955 in Bonn geboren, war Autor, Universitätsdozent, Übersetzer, Herausgeber und Korrespondent, ehe er 1991 zum Fernsehen kam, wo er in den folgenden 15 Jahren gut zweitausend Interviews führte, Kultursendungen produzierte, Filme drehte. Er interviewte unter anderem Audrey Hepburn, Yassir Arafat, Michail Gorbatschow, Madonna, Yehudi Menuin, Pierre Boulez, Margaret Thatcher und den Dalai Lama. Willemsen wurde mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Grimme-Preis in Gold. Inzwischen steht er mit Stand Up-Programmen auf deutschen Bühnen. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt.
Zuletzt erschienen „Afghanische Reise“, „Hier spricht Guantánamo“, das mit dem Rinke-Preis ausgezeichnete Buch „Der Knacks“, sowie „Bangkok Noir“ und das in diesem Jahr (2014) veröffentlichte Buch „Das Hohe Haus. Ein Jahr im Parlament“, das wochenlang die Bestsellerlisten anführte.
Fotocredit:
Helene Souza (1) | pixelio.de
Sebastian Bernhard (2) | pixelio.de
Jerzy Sawluk (3)| pixelio.de
Anita Affentranger (4)