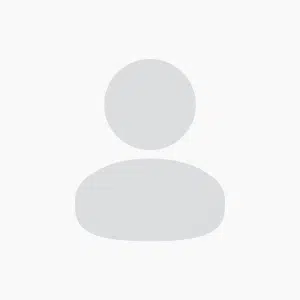Eine funktionierende Personalbedarfsplanung ist in der bewährten Praxis zumeist ein mehrstufiger Prozess, der sich dem zu gestaltenden Personalplan in mehreren Schritten annähert.
Schritt 1: Der „Rohbedarf“ aus dem originären Wertschöpfungsprozess
In einem ersten Schritt überlegt der Planer, wie viele Personen das Unternehmen benötigt, um die jeweiligen geschäftlichen Aktivitäten erledigen zu können. Je nach Geschäftsfeld finden sich die Rohdaten für diesen Planungsschritt in der Vielzahl der betrieblichen Daten und Fakten. Hier einige Beispiele:
- Im Handel interessiert, wie viele Kunden zu welchen Zeiten in das Geschäft kommen.
- Ein Produzent überlegt, welche Maschinen er braucht, um das Produktionsprogramm der nächsten Woche zu realisieren.
- Im Call Center beeinflusst die Anzahl der Anrufe und die Dauer der Telefonate den Personalbedarf.
- Im Krankenhaus beschäftigen sich die Verantwortlichen mit der Frage, wie viele Patienten zu versorgen und wie viele qualifizierte Pflegekräfte dafür erforderlich sind.
Die Basisdaten für diese Überlegungen stammen aus unterschiedlichen Quellen: Kassenterminals erfassen Kundentransaktionen und Umsätze, Telefonanlagen zeichnen die Anzahl und Dauer der geführten Telefonate auf, Bestellmengen und Produkttypen bestimmen über Maschinenbelegung und interne Materialbewegungen, in einem Spital gibt es umfassende Aufzeichnungen über die Anzahl, Dauer und Art von Operationen.
Wenn wir nun wissen, wie lange eine Transaktion dauert, dann erscheint die Frage nach der erforderlichen Anzahl an Arbeitsstunden (und damit nach der benötigten Personalzahl) einfach. Doch auf dem Weg dorthin liegen einige Stolperstein für die Planer bereit:
>> Die Durchschnittsfalle:
Mittelwertberechnungen über einen längeren Zeitraum eignen sich nicht gut für die Planung. Sie geben bestenfalls (wenn überhaupt) eine Indikation für einen Gesamtbedarf, im konkreten Zeitpunkt ist der längerfristige Schnitt fast immer falsch.
Dies zeigt ein Beispiel aus einem Call Center: Zu wissen, dass die Mitarbeiter in einer Woche im Mittel 12.500 Telefonate führen, hilft nicht wirklich und es wird auch noch nicht leichter, wenn wir wissen, dass ein Telefonat im Schnitt 2:45 Minuten dauert. „Warum nicht?“, könnte man sich jetzt fragen. Einfach gerechnet sind circa 34.600 Minuten (oder umgerechnet fast 580 Arbeitsstunden) für die Bearbeitung dieser Telefonate nötig. Wenn nun ein Vollzeit-Beschäftigter 38 Stunden wöchentlich arbeiten kann, dann braucht das Call Center 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Telefonate zu erledigen – oder? Ein zweiter Blick auf die Details offenbart jedoch, warum 15 Personen das Call Center nicht betreiben können.
Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Telefonate (aufgesplittet in 15 Minuten-Intervallen) über die Woche und innerhalb der einzelnen Tage einer Woche.Was lässt sich aus dem Bild herauslesen?
- An Vormittagen kommen deutlich mehr Anrufe herein als am Nachmittag.
- Am Montag (rote Linie) ist besonders viel los.
- Am Nachmittag liegt die Auslastung allerdings an 3 von 5 Tagen unter dem Schnitt.
- Ab 16 Uhr nimmt die Aktivität deutlich ab.
- Am Freitag begeben sich offensichtlich auch die Kunden gerne schon ab Mittag in das Wochenende und man kann mit deutlich weniger Personal arbeiten.
Nach dieser Analyse wird klar, warum in der Abteilung (die tatsächlich zum Zeitpunkt der Analyse 16 Mitarbeiter hatte) die Arbeitswoche für die Leute mit echtem Stress begann und die daraus resultierende physische und psychische Überlastung weit in die Woche hineinreichte.
Nun weiter mit den Stolpersteinen:
>> Prozesszeiten sind nicht immer gleich zu setzen mit produktiven Arbeitszeiten:
Verstärkt wurde der Druck im konkreten Fall noch dadurch, dass wir bei der Planung nicht davon ausgehen können, dass eine Arbeitsstunde 60 „produktive“ Minuten hat. Durch persönliche und sachliche Verteilzeiten (zum Beispiel Kurzpausen, Unterbrechungen zwischen Telefonaten oder administrative Vorgänge) reduzieren sich die für Telefonate verfügbaren Netto-Zeiten rasch auf 45 bis 50 Minuten pro Stunde. Nach zwei weiteren Analysen, die unter anderem zeigten, dass sich auch die Dauer der Telefonate über die einzelnen Tage und Stunden deutlich unterschiedlich entwickeln, und noch mitbetrachtend, dass ein Teil der Telefonate mangels Kapazität gar nicht mehr angenommen werden konnte, ließ sich der tatsächliche Netto-Personalbedarf ermitteln: Dieser lag (aufgerundet) bei 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
>> Hinzu kommt die Problematik der Abwesenheiten:
Unter Einrechnung von Urlauben und Krankenständen (die in Österreich häufig bis zu 16-17 Prozent der Arbeitszeit in Summe ausmachen) wurden der Abteilung 24 Personen zur Verfügung gestellt, für die dann ein spezieller Dienstplan aufgesetzt werden konnte. Damit sind wir schon bei den weiteren Schritten der Bedarfsplanung.
Schritt 2: Netto-Bedarf um Kapazitätspuffer und Mindestbesetzungen ergänzen
In dieser Phase stellt sich oftmals die Frage, ob sich der in Schritt 1 festgestellte Nettobedarf im täglichen Ablauf wirklich einem Personalbesetzungsplan zugrunde legen lässt. Zu prüfen ist beispielsweise, welche „Sicherheits-Reserven“ das Unternehmen für Abweichungen im Prozess vorhalten sollte. Der Notfall-OP eines Unfallkrankenhauses kann seine Kapazitäten nur schwer ohne Pufferplanung aussteuern. In einem biopharmazeutischen Produktionsprozess lässt sich nicht auf die Minute (manchmal nicht einmal auf die Stunde genau) vorhersagen, wann ein Bearbeitungsschritt abgeschlossen ist. Da muss die Personalplanung gewisse Überlappungen und zusätzliche Ressourcen vorsehen.
Eine weitere Überlegung in diesem Zusammenhang sind sicher auch prozesskritische Mindestbesetzungen, ohne die ein Ablauf nicht mehr abgesichert werden kann. Wenn zum Beispiel in einer Bankfiliale aus Sicherheitsüberlegungen nicht weniger als zwei Personen anwesend sein sollen, dann legt das eine klare Mindestbesetzungsstärke fest, ohne die eine Filiale völlig unabhängig von jeder Kundenfrequenz einfach nicht aufsperren kann. Weitere Notwendigkeiten ergeben sich oft aus Gründen der Sicherheit (zum Beispiel bei der Polizei) oder der Verfügbarkeit (Notarzt). Abbildung 2 zeigt das Verhältnis von tatsächlicher Arbeit und notwendigen personellen Puffern.
Schritt 3: Den Bedarf „modellieren“, um Spitzen und Lücken auszugleichen
Nicht selten ergeben die Schritte 1 und 2 einen Personalbedarf, der innerhalb eines Arbeitstages phasenweise Spitzen und auch Unterauslastungen aufweist (in der Fachsprache spricht man manchmal von Über- oder Unterdeckungen). Da stellt sich die Frage, ob gestaltend eingegriffen werden kann, um eine kontinuierlichere Auslastung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu ermöglichen. Welche Aktivitäten sind nicht einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet (wie das Einräumen der Regale im Handel)? Welche Aktivitäten lassen sich eventuell verschieben, um kurzfristige Spitzenbedarfe zu reduzieren? Wie lassen sich Zeiten der Unterauslastung sinnvoll nutzen?
Oft bieten administrative Vorgänge (Schriftverkehr, Dokumentation, Statistiken), deren Abarbeitung nicht zeitkritisch ist, gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Ein mitunter positiver Nebeneffekt davon ist die inhaltliche Anreicherung der Arbeitsinhalte für die Beschäftigten. Manchmal lässt sich ein solches Zeitfenster auch gut für Besprechungen oder kurze Schulungen nutzen.
Nach solchen gestaltenden Eingriffen sieht der dann vorliegende Personalbedarf oft ein gutes Stück anders aus und lässt sich in der angepassten Form besser einer konkreten Dienstplanung zugrunde legen.
Schritt 4: Erstellen eines Besetzungsplanes
Auf der Grundlage eines gut modellierten Bedarfsplanes lässt sich dann ein Besetzungsplan erstellen. In Schritt 4 legen die Planer die Zeitfenster fest, in denen Mitarbeiter anwesend sein sollen und sie definieren dabei auch die anzustrebende Besetzungsstärke.
Mit der Besetzungsplanung entsteht oftmals auch schon die Grundstruktur für einen Dienst- oder Schichtplan, den die Planer dann in der Folge mit konkreten Personen befüllen müssen. Allerdings kommen noch weitere Überlegungen hinzu: Lässt sich die Besetzung ohne Rücksicht auf die erforderliche Qualifikation planen? Wie weit sind in den einzelnen Lagen spezielle Qualifikationen (zum Beispiel Fach-/Spezialwissen) erforderlich? Manchmal ergeben sich auch Zeitlagen beziehungsweise Zeitlängen, die sich nur teilweise mit Vollzeitbeschäftigten abdecken lassen – und Unternehmen müssen an eine Kombination mit Teilzeitmitarbeitern denken.
Die Profis unter den Personalplanern wissen, dass sie damit noch nicht fertig sind. Ein umfassendes Planungskonzept muss dann in der Folge strukturierte Vorsorgen für Abwesenheiten treffen, zum Beispiel für Urlaube, Krankenstände und sonstige Dienstverhinderungen. Mit all diesen Inputs lässt sich dann ein Arbeitszeitplan aufsetzen. Welche Herausforderungen anschließend warten und worauf Planer achten sollten, werden wir in Kürze in einem weiteren Beitrag auf HRM.at darstellen.