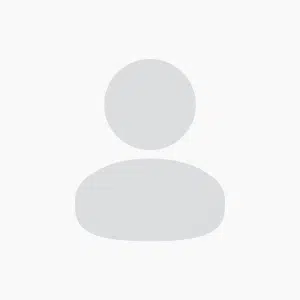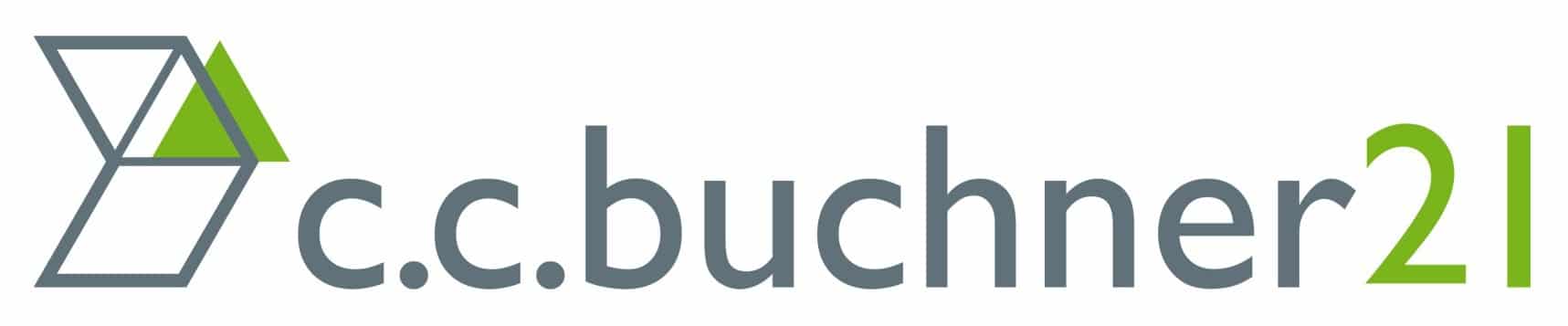Geändertes Umfeld

Viel zu schnell gewöhnen wir uns daran, dass Produkte uns nicht nur physisch, sondern auch mental entlasten: Navigationssysteme zählen bald zur Normalausstattung in Autos, Mobiltelefone fungieren als Minicomputer, die Namen, Zahlen, Zeiten und Orte speichern, unzählige Filme, Bücher, Kurzratgeber stehen uns auf Reisen in entlegene Gebiete zur Verfügung. Biogenetiker arbeiten in ihren Versuchslaboren an Ersatzzellen und Nanorobotern, die unseren Körper reparieren sollen, wenn wir ihn wider besseres Wissen durch unsere Lebensweise schädigen.
Immer mehr Menschen erleben die Berufswelt ähnlich. Sie sitzen vor einem Bildschirm und gehen mit Programmen um, die es ihnen erlauben, Symbole zu verarbeiten. Die Zahl dieser Symbole nimmt dramatisch zu: Jedes Jahr seit Beginn des 21. Jahrhunderts werden mehr Bytes als Daten, Formeln, Texte, Grafiken, Bilder und Filme produziert als in der westlichen Geschichte bis zum Beginn dieses Jahrhunderts aufgezeichnet wurden. So erwies sich die strittige amerikanische Praxis, unbescholtene Bürger abzuhören beziehungsweise ihren E-Mail-Verkehr zu überwachen, in der Praxis des FBI als Bumerang: Zu vielen Mitarbeitern wurden zu viele Daten zugespielt, was den ganzen Betrieb lahm legte, sodass sich dessen Direktor gegen die Übermittlung weiterer „Sicherheitsdaten“ zur Wehr setzte.
Die beschriebene Situation einer zunehmenden Symbolarbeit und eines exponentiellen, wenn nicht explosiven Wachstums von Wissen bezeichnen wir als Wissensgesellschaft. „Wissen“ steht weltweit immer schneller zur Verfügung. Immer mehr Menschen arbeiten wissensbasiert, die Preise für Arbeit und nichtstrategische Rohstoffe verfallen relativ zur Intelligenz, die in Produkten steckt: Wir bezahlen nicht für Baumwolle und Näherinnenstunden, sondern für Designer- und logistische Intelligenz, wenn wir ein T-Shirt in einer Boutique erstehen. Schwellenländer holen rasch auf, Forscherinnen können von anderen Nationen durch gute Ausstattung abgeworben werden – eine Strategie, die zum Beispiel Singapur sehr erfolgreich betreibt. Westliche Anbieter müssen daher ihre Rolle im Geflecht internationaler Arbeitsteilung neu definieren.
Diese beträchtlichen Herausforderungen rufen nach Antworten. Eine Antwort heißt Wissensmanagement und umfasst das systematische und bewusste Lösen von Problemen, die sich den entwickelten Ländern stellen:
- Weltweiter Wettbewerb (bei weltweiten Marktchancen)
- Hohe Arbeits- und Wohlfahrtsstaatskosten verlangen nach einer hohen Wertschöpfung. Diese Wertschöpfung kann nur auf der Intelligenz der Forschung, des Designs, der Vertriebskanäle, der Kommunikation und der Mitarbeiterführung beruhen.
- Technische Möglichkeiten und eine jährliche Zunahme an Wissensproduzenten führen zu einer Datenfülle, die immer schwerer zu bewältigen ist.
Lässt sich Wissen managen?
Ein großer Teil des Wissens, das wir benötigen, um die genannten Herausforderungen zu meistern, ist flüchtig, an Denkprozesse gebunden, in Organisationen und der Gesellschaft verteilt, in Ablaufroutinen, technischen Aggregaten und Personennetzwerken eingebettet. Volle Eigentumsrechte, aber auch begrenzte Verfügungsrechte an einem solchen Wissen können kaum definiert, es kann daher auch nicht in Bilanzen aktiviert werden. Ein solches Wissen lässt sich nicht managen, zumindest nicht im traditionellen Sinn eines technizistischen Beherrschens. Lediglich Daten lassen sich planen, organisieren und kontrollieren.
Wissensmanagement als Datenmanagement
In der Managementtheorie und -praxis spielt der eher mechanistische Umgang mit Produktionsfaktoren eine wichtige Rolle. Es kann daher nicht überraschen, dass Wissensmanagement zunächst nur als neues Etikett für die Aufgabe verstanden wurde, mit der Fülle an Daten, die ein Unternehmen produziert, besser umzugehen – sie zu lokalisieren, zu dokumentieren und in Strukturen zu speichern, die gewährleisten, dass sie später wieder aufzufinden sind.
Leitende Idee hinter allen Versuchen, vorhandenes „Wissen“ elektronisch festzuhalten und verfügbar zu machen, ist jene, das Rad nicht ständig neu zu erfinden, flüchtiges Wissen aus Köpfen auf elektronische Träger zu übertragen und generell mehr Transparenz darüber zu schaffen, über welches Wissen die Organisation verfügt. Ein viel zitierter Satz dazu lautet: „Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß.“
Geeignete Instrumente für diese Form des Wissensmanagements sind das Intranet, Datenbanken, Suchmaschinen oder Shareware, also Software, die mehrere Anwender gemeinsam nutzen können, zum Beispiel um einen Bauplan zu erstellen. Hinzu kommen Gelbe Seiten, also Verzeichnisse der Wissensträgerinnen einer Organisation.
Wissensmanagement in Form von Datenmanagement fördert das Bewusstsein für die Ressource „Wissen“ im Unternehmen. Organisationen, die diesen Ansatz verfolgen, können die Verarbeitung, die Struktur und die Visualisierung ihrer Daten verbessern. In der Vergangenheit hat sich jedoch vielfach gezeigt, dass akkumulierendes „Wissens“-Management das Problem des Information-Overkill eher verschärft als löst. Datenbanken sind lediglich ein erster Schritt auf dem Weg zum Wissen. Wenn keine weiteren Schritte erfolgen, werden sie zu Datenfriedhöfen und verursachen unproduktive Wartungskosten.
Wissensmanagement als Prozessmanagement und Ausdruck von Professionalisierung
Beim bloßen Sammeln und Aufzeichnen bleibt es daher in vielen Unternehmen und Institutionen nicht. Stattdessen gehen immer mehr dazu über, parallel zu den vorhandenen Daten ihre operativen Prozesse zu analysieren und zu optimieren. Wissensmanagement bezeichnet in diesem Fall die Gesamtheit aller Initiativen, Vorgänge in Unternehmen, die bislang auf Grundlage von Tradition oder Intuition vollzogen wurden, zu analysieren und zu verbessern.
Zur diesem Ansatz passen Balanced Scorecards, Prozesshandbücher, Customer-Relationship- und Qualitätsmanagementsysteme. Hinzu kommen Vergleiche mit Vorbildunternehmen oder zumindest einem Durchschnitt der eigenen Branche (Benchmarking). Wissensmanagement als Prozessmanagement ist Controlling: Die Unternehmen speisen Kennzahlen als Zielwerte in Prozesse ein, messen ihren Erreichungsgrad, analysieren die Abweichungen und definieren gegebenenfalls Gegenmaßnahmen. Bei den Kennzahlen muss es sich nicht unbedingt um finanzielle Indikatoren handeln.
So konnte ein 5-Sterne-Hotelier im Tiroler Außerfern nach Einführung einer Balanced Scorecard seine Auslastung steigern und seine Kosten senken, indem er Kundendaten und Mitarbeiterfeedbacks gründlich auswertete sowie einige wenige Kennzahlen, wie den Material- und Energieverbrauch und die Zahl der Reklamationen laufend im Benchmark-Vergleich kontrollierte. Selbst wenn er sein Betriebsergebnis vor allem durch seine charismatische Führung und sein hervorragende Betriebsklima steigerte: Sein Wissen unterstützte das operative Management.
Er weiß heute aufgrund systematischer Recherchen und Auswertungen seiner Kundendaten nicht nur, was holländische Gäste im Allgemeinen wollen (das wissen auch alle Konkurrenten über den Tourismusverband), sondern er ist in der Lage, einer ganz bestimmten holländischen Familie, die mit Mountainbikes anreist, ihre ganz speziellen Wünsche zu erfüllen. Technik und Methoden liefern Möglichkeiten, „weiche“ Faktoren wie Kultur und Führung entscheiden über deren Wirksamkeit.
Systemisches Wissensmanagement als Antwort auf Komplexität
Mit den genannten Bezügen zum Daten-, Dokumenten- und Prozessmanagement sind die Herausforderungen der Zeit jedoch noch nicht bewältigt, obwohl diese Bereiche in fast allen Unternehmen Verbesserungspotenziale aufweisen. Die größte Herausforderung für die Unternehmen besteht darin, ihre Innovationsfähigkeit zu unterstützen. Damit ist die Königsdisziplin im Wissensmanagement angesprochen – die innovative lernende Organisation. Wie Unternehmen sie fördern können, füllt mittlerweile Bibliotheken, daher seien hier nur Prinzipien und einige konkrete Umsetzungen genannt.
Lernende Organisationen …
- … versuchen nicht mehr, Abläufe und Menschen direkt zu steuern, sondern geben indirekt durch Ressourcen und Beschränkungen einen Handlungskorridor vor (zum Beispiel Führen durch Visionen, durch Ziele, durch Budgets, Motivation oder durch Freiräume).
- … beschränken sich auf das Wesentliche, beobachten sehr genau und reflektieren die Reaktion der Umwelt auf eigene Handlungen. Nach-Denken gilt als produktive Arbeit, Aktion um der Aktion willen ist verpönt.
- … bemühen sich um möglichst offene Kommunikation, pflegen die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, und unterstützen Möglichkeiten eines informellen oder halb formellen Erfahrungsaustausches („Wissensmanagement by Kaffeeautomat oder Kopierer“)
- … bekennen sich zur Personalentwicklung, ohne die Mitarbeiterinnen in die Fänge der jeweils neuesten „Psychogurus“ zu schicken.
- … predigen nicht nur Vielfalt, sondern leben sie. Das Motiv, Menschen und Prozesse zu beherrschen, ist in ihnen weniger stark ausgeprägt. Sie fördern laterales Denken im Gegensatz zum Denken in gewohnten Bahnen.
Zu dieser Leitidee von Wissensmanagement passt der Begriff Management eigentlich schon nicht mehr, doch wurde noch kein besserer gefunden. Sie wird unterstützt durch kontrollierte Experimente mit rascher Rückmeldung (Rapid Prototyping), durch Communities of Practice (Erfahrungsaustauschgruppen), vor allem aber durch eine Kultur der Offenheit und Bescheidenheit in Bezug auf die Sicherheit des eigenen Wissens. Umfassendes Wissensmanagement kombiniert die drei genannten Zugänge. Es beinhaltet ein Management der Daten und Dokumente, der Prozesse und des Kontexts. Es ist eine Reaktion auf Herausforderungen durch Globalisierung und den technischen Fortschritt.
Obwohl am Markt sehr viele Verfahren und Werkzeuge angeboten werden, sind Unternehmen gut beraten, Wissensmanagement nicht von der Stange zu kaufen, sondern aus den Angeboten das zu suchen und anzupassen, was ihrem Herausforderungsstand entspricht. Weniger ist auch hier paradoxerweise mehr.
Quelle: personal manager 2/2006