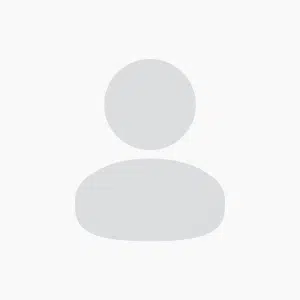Und im Marketing gehört die Übertreibung ohnehin schon immer zum Standardrepertoire. Ein Schokoladenriegel wird so zur längsten Praline der Welt, und ein Automobilkonzern, der auch Weltmarktführer bei schweren Lastwagen ist, wirbt nun sogar mit dem Leitsatz seines Gründers für sich: „Das Beste oder nichts“. Deutschland ist vermutlich sogar Weltmarktführer in der Zahl seiner Weltmarktführer. Auch im Personalbereich stehen gerne „die Besten“ im Mittelpunkt. Nicht wenige Unternehmen zählen sich in ihrer Selbstdarstellung dazu und leiten daraus umgehend auch den Anspruch ab, die besten Bewerber für sich gewinnen zu wollen. Diese wiederum verweisen nur allzu gerne auf die besten Noten, die sie vorzuweisen haben sowie die besten Hochschulen, an denen sie Top-Qualifikationen erworben haben.

Es scheint manchmal so, als sei eine Art Bestenrausch ausgebrochen. In der grauen Praxis des Alltags stellt sich dabei allerdings schnell Ernüchterung ein. Denn viele Unternehmen schießen in Ihrem Eifer bei der Formulierung ihrer Ansprüche an mögliche Bewerber über das Ziel hinaus. Langjährige Personaler reagieren mit routinierter Resignation auf den Wunsch einer Fachabteilung nach der eierlegenden Wollmilchsau wie dem 25-jährigen, promovierten Prozessingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung im In- und Ausland.
Mitunter glauben Fachvorgesetzte auch, sich mit besonders strengen Anforderungsprofilen für neue Mitarbeiter schmücken zu können. Die hoch gelegten Hürden führen am Bewerbermarkt meist zu ausbleibender Resonanz. „Gute Leute sind halt schwer zu finden“, kann man dann wieder feststellen. Geholfen ist niemandem. Auch in der Selbstdarstellung neigen Unternehmen auf Mitarbeitersuche gerne zur vollumfänglichen Übertreibung. Spannende Aufgaben, attraktive Vergütung, beste Perspektiven und natürlich ein tolles Team bestehend aus den jeweils Besten ihres Fachs sind selbstverständlich. Mitunter führt dies zu einer Art kognitivem Kurzschluss, und Unternehmen glauben plötzlich, was sie im Wunsch nach positiver Außenwirkung über sich selbst erzählen.
Bewerber fühlen sich hingegen schnell abgeschreckt von zu viel zur Schau gestellter Perfektion oder machen sich im Verlauf eines Bewerbungsverfahrens, spätestens bei ersten direkten Gesprächen ihr eigenes Bild vom Gegenüber, das oft ein ganz anderes ist. Und nicht zuletzt muss ein Unternehmen an die eigenen Mitarbeiter denken. Denn auch die schauen sich gelegentlich Stellenanzeigen an und fragen sich möglicherweise irritiert: „Ist das meine Firma, und warum habe ich von all diesen Vorzügen noch nichts gemerkt?“
Bei allem gesunden Selbstbewusstsein wäre etwas mehr Realismus für viele besser. Die Welt besteht nicht nur aus den Besten. Nicht jeder kann der Beste sein. Und für die Besten gilt: Nicht alle können sie bekommen. Denn diese wollen ihrerseits auch nur zu den Besten.
Bei genauerer Betrachtung muss zudem gefragt werden, wodurch sich die Besten überhaupt auszeichnen. Worin und wofür sollen Menschen die Besten sein? Geht es um Noten, Wissen, Intelligenz, Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten – oder wenden wir uns endlich den Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen zu? Dann merken wir, dass es für die meisten Unternehmen gar nicht darum geht, die Besten zu finden, sondern vielmehr diejenigen, die am besten zu ihnen passen. Das Signet der Besten als Kategorie von Menschen wird angesichts der Komplexität von Persönlichkeiten schlicht irrelevant.
Es spricht nichts dagegen, in einem Bereich der Beste zu sein und fortwährend besser werden zu wollen. Für manche Unternehmen allerdings läge der erste Verbesserungsschritt darin, sich nicht mehr selbst ohne weiteres zum Besten auszurufen, sondern stattdessen auf ihre tatsächlichen Qualitäten und Eigenschaften zu besinnen. Für viele würde es völlig ausreichen, einfach nur gut zu sein und passende Menschen für sich zu gewinnen. Als Mahnung ist vom französischen Philosophen Voltaire ein altes italienisches Sprichwort überliefert: „Das Bessere ist der Feind des Guten.“
Quelle: PERSONAL – Heft 09/2010