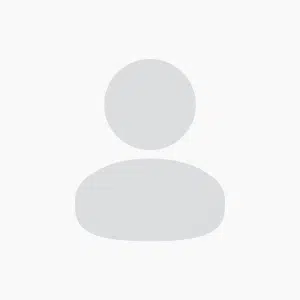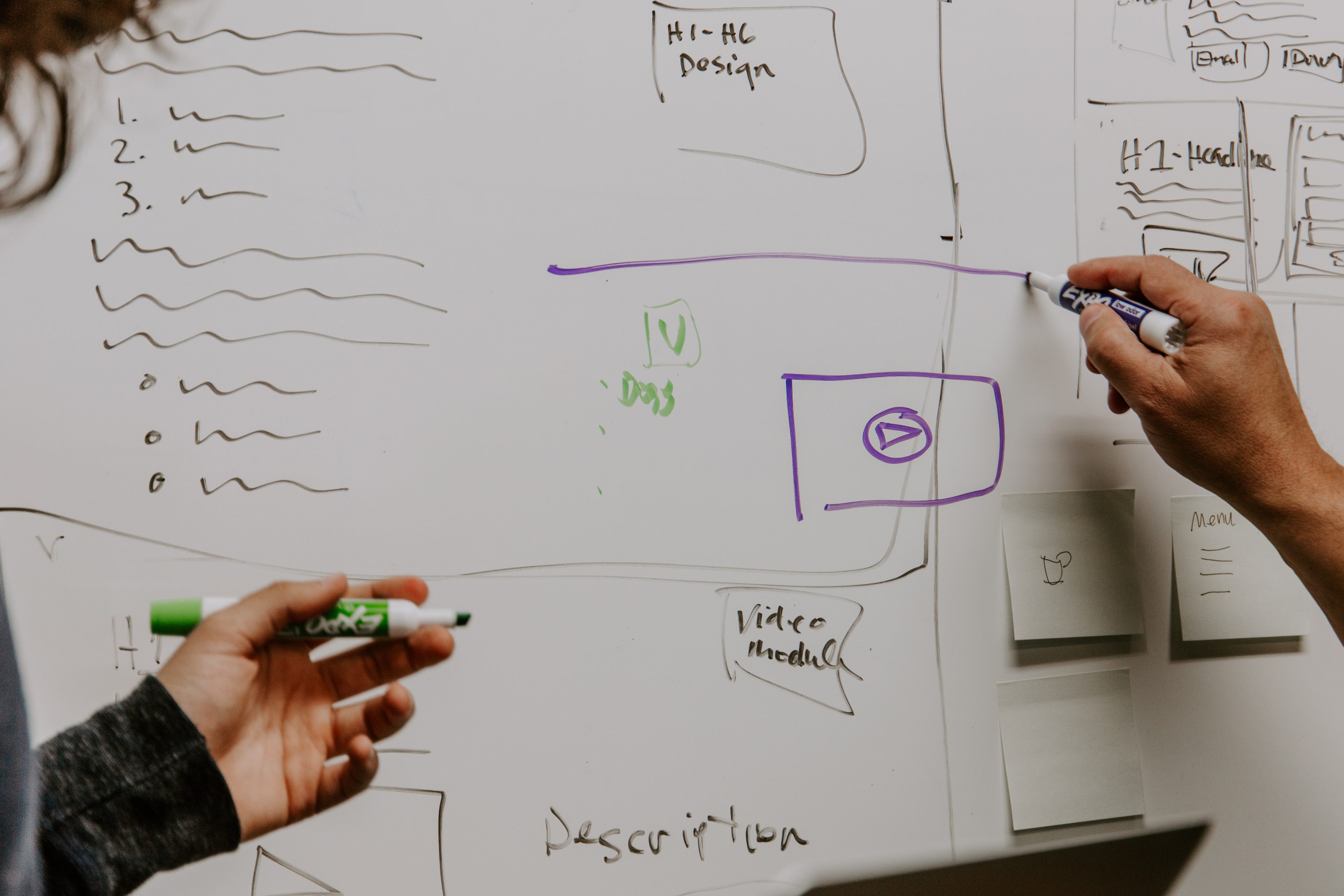Viele Gründer wollen das Recruiting verbessern

Auffällig dabei ist, dass sich viele Gründer vor allem auf das HR-Segment und hier insbesondere auf den Bereich Recruiting fokussieren. Für hokify-Chef Edlbauer kommt das nicht von ungefähr: „Der Fachkräftemangel ist ein branchenübergreifendes Phänomen. Aufgrund der guten Konjunktur suchen Arbeitgeber erheblich stärker als in den letzten zehn, fünfzehn Jahren nach Personal“, sagt er. „Allerdings sind die alten Methoden in die Jahre gekommen. Sie entsprechen nicht mehr dem Lebensspirit junger Leute. Diese wollen einfacher und schneller neue Dinge ausprobieren, und aus dem E-Commerce sind sie es auch gewohnt, dass vieles auf Knopfdruck geschieht, aber im Recruiting ist das noch nicht angekommen. Hier hat HR großen Nachholbedarf.“
Edlbauer ist überzeugt, dass Arbeitgeber nun aber bereit sind, neue Wege zu gehen. Die Studie Recruting Trends 2018, die die Universität Bamberg jährlich mit dem Karriereportal Monster erhebt, bestätigt, dass es sich bei dieser Einschätzung um mehr als nur ein vages Bauchgefühl handelt. Zum Beispiel sehen fast neun von zehn Top-1.000-Unternehmen einen großen Einfluss mobiler Endgeräte auf die Rekrutierung. Im Jahr 2011 vertraten im Gegensatz dazu nur knapp fünf von zehn diese Meinung.
Die meisten Unternehmen haben die Weichen dafür aber noch nicht gestellt. Oft kämpfen mobile Bewerber mit schwer ausfüllbaren Online-Formularen. Die Konsequenz: Sie springen ab und Arbeitgebern entgehen viele Chancen.
Faktoren für den Erfolg
Es gibt noch reichlich weitere Betätigungsfelder für junge HR-Startups. Die Kunst ist es allerdings, sich nach einem erfolgreichen Start langfristig zu halten, sagt Professor Markus Reitzig, Lehrstuhlinhaber für Strategisches Management an der Universität Wien.
Aber wovon hängen Erfolg und Misserfolg ab? In seinen Augen ist das eine schwer zu beantwortende Gretchenfrage: „Das hat teilweise etwas damit zu tun, dass man über nicht erfolgreiche Unternehmensgründungen tendenziell weniger erfährt als über die Erfolgsstorys“, so Reitzig. „Innerhalb dieser Gruppe, so zeigen viele Studien, gibt es aber doch etliche Faktoren, die Abstufungen von Erfolg erklären. Einige der Faktoren sind von den Unternehmensgründern selbst schwer zu beeinflussen, wenn die Ortsansiedlung einmal beschlossen ist.“
Dazu gehört die Lebensqualität vor Ort, die sich unmittelbar auf die Attraktivität eines Arbeitgebers auswirkt. Außerdem kommt es auf gesetzliche und regulatorische Besonderheiten im Firmenumfeld an, auf die Finanzierungsbedingungen sowie auf das Ökosystem, das die Firma umgibt.
Es gibt aber auch Einflussgrößen, die Unternehmensgründer sehr wohl steuern können. Angefangen mit der Wahl des Produkts, der Art des Auftritts bis hin zu bestimmten „Soft Factors“: beispielsweise der Gestaltung des Miteinanders im Venture.
„Aus unserer eigenen Forschung können wir das bestätigen, stellen aber vor allem zusätzlich fest, dass das schnelle Lernen darüber, wie diese steuerbaren Größen mit Unternehmenserfolg zusammenhängen, essenziell ist“, konstatiert Reitzig. „Interessanterweise lassen sich einige Dinge viel schneller lernen als andere. So tun sich die von uns beobachteten Start-ups beispielsweise viel leichter damit, ihre möglicherweise irrigen Annahmen bezüglich gewisser Marktgegebenheiten anzupassen als ihre potenziell falschen Vorstellungen davon, wie man sich als Firma optimalerweise organisiert.“
Wien ist voller Start-ups mit klingenden Namen, die in der HR-Szene Aufsehen erregen. Zum Beispiel, weil die großen Player gerne die Hände nach ihren innovativen Ansätzen ausstrecken, um selbst davon zu profitieren. In die Schlagzeilen geriet erst kürzlich der E-Recruiting-Softwarehersteller Prescreen, als er für 17 Millionen Euro in dem Businessnetzwerk Xing aufging. Für Headlines sorgten auch die sechs Start-ups, die nun den „HR Tech Hub Vienna“ bilden. Das Berichtenswerte: von Konkurrenzdenken keine Spur. Stattdessen fühlt man sich der gemeinsamen Sache verpflichtet. Ziel ist es, eine unabhängige Plattform für junge HR-Tech-Unternehmen zu schaffen, um den Austausch zu vereinfachen. Der HR Tech Hub Vienna soll beispielsweise Standards schaffen, die eine Zusammenarbeit mit großen Softwareherstellern erleichtern. Außerdem will man gemeinsame Events veranstalten. Mit von der Partie sind Firstbird, Gustav, hokify, myVeeta, Prescreen und whatchado.
Wien als Hotspot für Start-ups
„Wien ist inzwischen zu einem HR-Hotspot für Start-ups geworden“, sagt Karl Edlbauer, Co-Founder und Geschäftsführer von hokify, dem Entwickler einer Job-App für Bewerber. Tatsächlich belegt die österreichische Hauptstadt in einem Start-up-Ranking der European Startup Initiative (esi) den zehnten Platz unter 30 europäischen Städten.
Die Attraktivität kommt nicht von ungefähr. Nimmt man allein die Förderprogramme von Bund und dem Standort Wien zusammen, stehen jährlich allein von staatlicher Seite rund 50 Millionen Euro für Jungunternehmer zur Verfügung. Das Fördersystem ist ein Alleinstellungsmerkmal für den Standort Wien.
Hinzu kommt eine große Förderbereitschaft privater Finanziers, die sich in Start-up-Investoren-Netzwerken wie der Austrian Angel Investors Association tummeln. „Die Gründungskultur in Österreich ist insgesamt eher spät entstanden, aber mittlerweile sehr dynamisch geworden“, bilanziert auch Birgit Reiter-Braunwieser, Direktor Mittel- und Osteuropa im Bereich Start-ups bei der Invest in Austria (ABA). Die ABA ist die erste Anlaufstelle für ausländische Unternehmen, die in Österreich eine eigene Gesellschaft gründen wollen.
Wohl wahr: Erst Ende letzten Jahres haben zum Beispiel Firstbird und myVeeta Investments in Millionenhöhe bekannt gegeben. Firstbird entwickelt eine Technologie, bei der die eigenen Mitarbeiter und der Bekanntenkreis zu Recruitern werden. myVeeta hilft Firmen derweil, ein Onlinenetzwerk für potenzielle Arbeitskräfte aufzubauen, um bei Bedarf freie Posten schnell nachbesetzen zu können.
Hürde Selbstorganisation
Diplom-Ingenieur Martin Schott, Programm-Manager am Gründungszentrum der Wirtschaftsuniversität Wien, weiß, wovon Reitzig spricht: „Start-up-Teams sind klein – jeder erledigt am Anfang jede notwendige Aufgabe. Es gibt nur selten Hierarchien und festgeschriebene Arbeitsabläufe. Ab einer bestimmten Größe ist das jedoch die Voraussetzung für eine effiziente und gesunde Arbeitskultur.“
Die wohl größte Herausforderung dabei: Die agilen Start-up-Strukturen nicht in den starren Prozessen einzubetonieren, wie man sie aus großen Konzernen kennt. Denn lange Entscheidungsstrukturen und starre Hierarchien hemmen nachweislich die Innovationskraft.
Den Mitarbeitern von whatchado ist diese Problematik alles andere als fremd. Die Firma entstand 2010, als drei Kindheitsfreunde anfingen, Menschen in Bewegtbild über ihre Sicht der Arbeitswelt erzählen zu lassen, um anderen mit ihren Erfahrungen Orientierung im Beruf zu geben. Die Idee schlug ein, Investoren gaben Finanzspritzen in Millionenhöhe und inzwischen ist der Betrieb 35-Mann-und-Frau-stark.
Jubin Honarfar, CEO und Co-Founder, weiß, was es heißt, wenn der Betrieb wächst und Prozesse mangels klarer Abläufe aus dem Ruder zu laufen drohen. „Wir mussten die ein oder andere schmerzhafte Erfahrung machen, sind aber gerade dabei, uns strukturierter aufzustellen“, sagt er.
Wobei er zwischen operativem und dem kreativen Tagesgeschäft unterscheidet. „Nehmen wir die Produktionsplanung unserer Videos: Hier haben wir die Aufträge unserer Kunden zu erfüllen. Daher muss klar sein, welche Videos in welchem Zeitraum gedreht werden, wer involviert ist und welche Punkte in der Organisation noch offen sind. Hierfür brauchen wir ein gut funktionierendes System.“ Das unterscheidet ein Start-up nicht von einem etablierten Unternehmen.
Neue Formen der Zusammenarbeit
Dann gibt es da aber noch die andere Frage, die sich das Team von whatchado aktuell stellt, nämlich: Wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? Hier peilt das Team eine Form der Zusammenarbeit an, die mit den klassischen Strukturen größerer Player nichts gemein hat. Stichwort: Holacracy. Ein Managementsystem, das klassische Management-Hierarchien durch selbstorganisiertes Arbeiten ersetzt.
„Wir haben das Modell Holacracy noch nicht umgesetzt und werden sicherlich auch nur Elemente, die auf uns zutreffen, als Organisation übernehmen. Wir wollen aber weg von dem Vorgesetztenmodell, nach dem einer vorgibt und alle anderen ausführen. Stattdessen sollen Mitarbeiter ihre Potenziale frei entfalten und sich mit ihren Ideen einbringen“, sagt Honarfar. Dazu gehört zum Beispiel, dann zu arbeiten, wenn die Ideen sprudeln, und nicht, wenn es die Stechuhr verlangt. Wichtig dabei ist nur, immer mit den Mitarbeitern im Austausch zu stehen, mit denen man gemeinsam an einem Projekt arbeitet.
Honarfar vertraut da ganz auf die Selbstorganisation seiner Angestellten. „Der Mitarbeiter weiß am ehesten, woran er arbeitet und in welchen Abhängigkeiten, das kann er meist besser abschätzen als der Vorgesetzte. Daher sollten sich die Mitarbeiter untereinander organisieren.“
Was das Start-up dabei wohl am Wesentlichsten von den alten Strukturen in Konzernen unterscheidet: Die fehlende Angst vor Trial and Error. „Wenn wir merken, wir brauchen wieder mehr Struktur, stellen wir den Prozess einfach wieder um oder passen ihn an. Wo liegt das Problem?“ Ja, wo eigentlich?
Quelle: Dieser Beitrag ist in Ausgabe 5/2018 der Zeitschrift personal manager erschienen. www.personal-manager.at