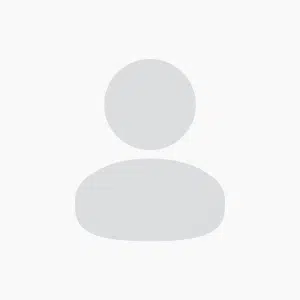Im Strudel der Medienberichterstattung gewinnt man den Eindruck, die gesamte Umwelt sei krisenhaft geprägt: Auf betriebswirtschaftlicher Ebene verwirft die Digitalisierung Wertschöpfungsmodelle ganzer Branchen, auf volkswirtschaftlicher Ebene herrscht ein beklagenswert geringes Wirtschaftswachstum und zu allem Überfluss überlagern politische Krisen von Brexit bis Migration die Diskussion. Dabei entsteht rasch das Bild einer gänzlich unübersichtlichen Gesamtsituation, die zu komplex und volatil ist, um noch mit langfristiger Planung bearbeitbar zu sein.

Dieses düstere Außenbild hat nicht selten verheerende Konsequenzen für das Innere von Unternehmen. Aus dem Alarmismus der permanenten Bedrohungslage entsteht dann ein ängstlicher Blick auf die Zukunft und ein in sich gekehrtes Betriebsklima. Konsequenz: Das Vorsichtige und Beharrende legt sich über Vorstandsdebatten und Managemententscheidungen. In diesem Klima blühen neue Kontrollinstrumente auf, um für Stabilität zu sorgen. Dieses systemerhaltende Mikromanagement auf allen Ebenen ist jedoch ein gefährliches Trugbild, denn statt stabilisierend zu wirken, verhindert es notwendige Veränderungen und steht damit der Innovationsbereitschaft des Betriebes diametral gegenüber.
Was jetzt gefragt ist: mehr Mut!
In fordernden und unsicheren Zeiten finden Reformverweigerer oft Mehrheiten bei Beschlussfassungen. Statt über radikal neue Geschäftsmodelle oder dynamisierte Organisationsstrukturen jenseits von Lippenbekenntnissen nachzudenken, wird aus falsch verstandenem Sicherheitsdenken marginalen Produkt- und Prozessverbesserungen der Vortritt gelassen. Wenn aber Unternehmen im Wettbewerb um Wachstum und Marktanteile an die Spitze wollen, muss sich das ändern, und zwar rasch und konsequent. Führungskräfte brauchen jetzt vor allem eines: mehr Mut, Richtungen vorzugeben und mehr Bereitschaft, die Zukunft aktiv zu gestalten.
Zeiten radikalen Wandels sind immer auch ein fruchtbarer Boden für frische Ideen – anstatt über Krisen zu jammern, lohnt der Perspektivenwechsel: Wir leben in einer geradezu prototypischen Aufbruchszeit. Was zählt, sind die Erkenntnis, dass wirtschaftliches Handeln immer risikobehaftet ist, und die Bereitschaft, dieses Risiko aktiv zu gestalten. Ausgerechnet Mut, und nicht übertriebene Vorsicht, stärkt die Resilienz von Unternehmen.
Denn etwas auszuprobieren, auch mal riskantere Entscheidungen zu treffen, wird gerade in einer Zeit belohnt, in der die Maßstäbe der Vergangenheit immer weniger Gewicht haben, und auf der anderen Seite durch die Veränderungen der vernetzten, digitalisierten Wissensgesellschaft enorme neue Möglichkeiten entstehen.
Zukunftsorientierte Führungsarbeit muss daher mehr denn je auf der Grundlage einer positiv gestimmten Denk- und Handlungsweise im Umgang mit Unsicherheit und Risiko aufbauen. Auch mit maximalem Beharrungsvermögen sind die Umwälzungen der Welt, die sich in ständiger Bewegung befindet, nicht abwendbar. Führung ist demnach die Verantwortung, innerhalb des Unternehmens einen Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht, optimistisch mit diesen Dynamiken umzugehen, Zukunft zu gestalten und nicht gestaltet zu werden. Führungsarbeit darf deshalb nicht länger versuchen, Unternehmen durch ein engmaschiges System aus Fehlervermeidung und Kontrolle in vermeintliche Sicherheit zu betten, sondern soll Mitarbeiter unterstützen, selbstständig und mutig zu sein.
Verrückt, aber verantwortungsvoll
Brave Systemerhalter gibt es in allen Unternehmen mehr als ausreichend, wirklicher Bedarf herrscht an Verrückten. Zwar sind die Stellenanzeigen gefüllt mit der Suche nach innovativen Querdenkern, die neue Ideen mitbringen, doch selbst wenn es gelingt, sie an Bord zu holen, trifft sie die Dreifaltigkeit des Ideentodes: Das haben wir noch nie gemacht, das haben wir schon probiert und überhaupt, da könnte ja jeder kommen. Die Schlüsselfrage lautet daher nicht nur, wie das Neue ins Unternehmen kommt, sondern vor allem, wie es dort überlebt und aufblüht.
Dazu braucht es ein Biotop, eine Unternehmenskultur, die glaubwürdig darlegt, dass Unternehmergeist wichtig ist, dass Freiheitsgrade dafür bereitstehen und dass von der Spitze kein fein ziseliertes Vorgabenwesen kommt, sondern eine gute Vorstellung von der Richtung, die eingeschlagen werden soll.
Grundeigenschaften eines fruchtbaren Bodens für Intrapreneurship liegen auf der Hand:
► das Vertrauen, experimentieren zu dürfen,
► die Gewissheit, Sinnhaftes zu leisten,
► die Freiheit, eigenständiges Denken an-wenden zu können,
► die Transparenz, um Offenheit auch wahrzunehmen zu können.
Den Bedenkenträgern sei ins Stammbuch geschrieben: Unternehmerisches Handeln ist kein träumerischer Freibrief für eine Hurra-Mentalität des Draufgängertums. Der entscheidende Aspekt ist der Anspruch, wertstiftend, wertsteigernd und werterhaltend zu agieren, auch über den Quartals-Forecast und eine lineare Zukunftsperspektive hinaus. Dazu gehört eine sorgfältige Balance aus Verrücktheit und Verantwortung: Mitarbeiter sollen den Mut haben können, neue Pfade zu beschreiten, und gleichzeitig einen Rahmen vorfinden, in dem sie Verantwortung für ihr Tun übernehmen können.
Big Data, little Insight?
Durchlüftete Informationsstrukturen sind im Angesicht der Digitalisierung vergleichsweise einfach zu etablieren, zumindest technisch. Doch ein solcher Wandel muss auch organisatorisch begleitet werden. Mehr Information bereitzustellen reicht alleine nicht aus. Denn der Glaube an bessere Entscheidungsgrundlagen, wenn die Informationsmenge nur hoch genug ist, wird durch die Realität der Reizüberflutung längst erschüttert. Selbst erfahrenen Experten ist es unmöglich, angesichts der unfassbaren Menge von Daten und der Geschwindigkeit, mit der sie eintrudeln, richtige Schlüsse zu ziehen, geschweige denn optimale Entscheidungen zu treffen.
Uns Menschen bereitet Komplexität Stress, in der Folge beeinträchtigen große Datenmengen unsere Fähigkeit, Probleme zielführend zu bewältigen, miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Gerade für Führungskräfte ist das ein riskanter Cocktail, ziehen sie doch aus ihrer Entscheidungsfähigkeit und -qualität letztlich die Daseinsberechtigung im Unternehmen.
Im Tsunami der auf sie einströmenden Daten haben sich viele Führungskräfte persönliche Strategien zurechtgelegt, um dem kognitiven Kontrollverlust zu entgehen – vielfach auch unbewusst, und leider nicht selten mit unglücklichen Konsequenzen. Die einen begegnen dem inflationären Effekt der Menge an zur Verfügung stehenden Daten mit einer Deflation des Handelns; nach dem Motto „Morgen habe ich bessere Daten” vertagen sie die Entscheidung. Auf der anderen Seite des Spektrums steht der Hyperaktive, der beim kleinsten Skalenausschlag auf der Scorecard hektische Betriebsamkeit im Unternehmen auslöst.
Wo auch immer man sich selbst einordnet: Sich mit den psychologischen Effekten von Entscheidungsunsicherheit und erkenntnistheoretischen Fehlern auseinanderzusetzen, ist nicht nur augenöffnend, sondern notwendig. Allzu oft verlassen sich Führungskräfte weiterhin auf ihre Intuition oder auf kurzfristige Perspektiven und treffen demnach Entscheidungen im Anlassfall.
Die Economist Intelligence Unit hat in einer aktuellen Studie nachgewiesen, dass neun von zehn Führungskräften bereitgestellte Daten zur Seite schieben, wenn sie ihrer persönlichen Erfahrung nicht entsprechen. Doch Manager können sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie ein natürliches Talent für Entscheidungsfindung haben, zu vielschichtig und komplex sind die Faktenlagen. Damit zielführende Entscheidungen für Manager nicht zur illusorischen Fata Morgana werden, müssen sie eine neue Ökonomie der Entscheidungsfindung erlernen. Denn aus dem vernetzten System gibt es kein Zurück mehr in eine analoge, unvernetzte Welt. Auf operativer Ebene bedeutet das die Notwendigkeit zur Steigerung der Datenkompetenz, quer durch das Unternehmen und alle Hierarchiestufen übergreifend, und zur Dynamisierung der Entscheidungsarchitekturen, die vielfach noch aus ruhigeren Zeiten stammen.
Es reicht in Zukunft nicht mehr aus, zentral Big Data eingeführt und Data Scientists eingestellt zu haben: Führungskräfte aller Fachabteilungen müssen qualifiziert über datengestützte Entscheidungsmodelle verfügen und sie in ihr tägliches Handeln integrieren, sowie durch gestiegene Transparenz dezentrale Entscheidungsfindung in der Organisation ermöglichen.
Leadership wagen!
Mit Veränderungen auf instrumenteller Ebene oder Adaptionen des Organisationsmodells ist es jedoch nicht getan. Es geht ans Eingemachte, nämlich daran, die eigene Rolle als Führungskraft auf den Prüfstand zu stellen. Abnehmende Planbarkeit und unentscheidbare Lagebilder erschüttern das tradierte Rollenbild des Managers. Es braucht keinen starken Macher, der alles im Griff hat, sondern jemand, der sich angstfrei und neugierig auf unkalkulierbare Marktdynamiken einzulassen bereit ist und die Fähigkeit zur professionellen Gestaltung ergebnisoffener Prozesse hat. Führung im Wandel benötigt ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz und das Verständnis, dass Steuerung künftig weniger mit dirigistischen Eingriffen in das System zu tun hat, als mit Kulturarbeit unter hoher Achtsamkeit und Empathie.
Damit sind wir beim paradoxen Kern angelangt: Gerade das Übermaß an rationaler Informationsdichte erfordert ein Loslösen von kognitiven Strategien und vom mythischen Gedanken des unfehlbaren Entscheiders. Das bedeutet keineswegs, dass wir weniger Führung brauchen, sondern im Gegenteil: Mehr Führung, mehr Leadership – und dafür weniger Management. Der Ausweg aus der Komplexität liegt weiterhin in der Hand der Führungskraft, bloß gewinnt die normative und strategische Ebene der Führungsarbeit an Bedeutung, Leadership bedeutet mehr denn je Gestaltungswillen zu zeigen und Kultur vorzuleben.
Leichter wird Führungsarbeit dadurch nicht. Es ist persönlich fordernd, die Grenzen der eigenen Wirksamkeit anzuerkennen. Und wer auf Patentrezepte hofft, wie all das gelingen kann, oder im Glauben an leicht übertragbare Best Practices Methoden anderer Unternehmen kopieren möchte, wird rasch enttäuscht. Denn vieles ist noch unerforschtes und unerprobtes Terrain, für das Führungskräfte (und übrigens auch Berater!) nicht oder nur unvollständig ausgebildet sind. Umso wichtiger ist es, dass sie sich auf ein stabiles persönliches Grundgerüst an Werten und Haltungen stützen können, und in der Lage sind, durch das Gestalten einer entsprechenden Unternehmenskultur Orientierung und Sinn zu stiften. Führen bedeutet immer weniger Hoheit über strukturelle oder fachliche Prozesse zu besitzen, sondern auf kultureller Ebene zu wirken: Über Verhalten, Interaktionen, Symbole und über das beispielgebende Vorleben.
Denn natürlich hat eine mit hohen Freiheitsgraden ausgestattete Organisation ein hohes Zerstreuungspotenzial. Richtungsgebend kann in einem solchen System allerdings nicht mehr ein enger Korridor an Budgetplänen und minutiösen Zielvorgaben sein, die verbindende Kraft muss aus dem Kohärenzfaktor der gelebten Unternehmenskultur geschöpft werden.
Literaturtipp
Leadership Report.
Von Franz Kühmayer.
Verlag Zukunftsinstitut 2016.
———————————————————
Quelle: personal manager – Zeitschrift für Human Resources | Ausgabe 6 November/ Dezember 2016.
Von der Deutungshoheit zum fluiden System
Diese Haltung darf sich nicht nur auf der Ebene der persönlichen Interaktion zwischen Führungskraft und Mitarbeiter abspielen, sondern muss auch eine organisatorische Entsprechung finden. Denn für Teams, die Mut zum Risiko haben und den Status quo herausfordern, sind herkömmliche Organisationsstrukturen, Hierarchiestufen und Karrieremodelle wenig geeignet. Sie engen das Spektrum akzeptierter Handlungsweisen zu sehr ein. Unternehmen müssen also ein gewisses Maß an Ordnung aufgeben, wenn sie Intrapreneurship fördern wollen.
Immer mehr Führungskräfte erkennen, dass ihre Wirklichkeit nicht mehr mit simplen Ursache-Wirkungs-Prinzipien erklärbar ist. Auch top ausgebildete und bestens vernetzte Manager gestehen sich ein, dass an der Unternehmensspitze nicht mehr die Summe der Kompetenzen des Unternehmens vereint sein kann – und damit auch immer seltener die Deutungshoheit über Entscheidungen. Hat man das einmal verinnerlicht, wird klar, dass es sinnvoll ist, Vorgaben von oben zu reduzieren, und Freiheitsgrade für Mitarbeiter zu erhöhen.
Das Wagnis, selbstbestimmtes Arbeiten auch organisatorisch abzubilden, sind allerdings bislang nur wenige Unternehmen eingegangen. Dabei existieren eigenverantwortliche Systeme ohnehin meist direkt unter den Augen der Führungskräfte, deren Blick noch auf formale Strukturen gerichtet ist. Indessen sitzen die eigentlichen Entscheidungsträger oft ganz woanders. In der Realität der Ablauforganisation wird klar, dass das Organisations-Chart oft erstaunlich wenig über die tatsächlich wirksamen Strukturen im Betrieb aussagt. Wo und von wem Entscheidungen beeinflusst oder gefällt werden, ist vielfach eher ein Ergebnis informeller Prozesse als formaler Abläufe.
Die smarte Reaktion darauf lautet, nicht die x-te Reorganisation vom Zaun zu brechen, sondern Schneisen in tradierte Machtstrukturen zu schlagen und formelle sowie informelle Organisationen aneinander anzugleichen. Das steigert die Effektivität, verhindert Doppelgleisigkeiten und Leerläufe. Zugegeben, leicht ist das nicht, denn im Gegensatz zur formellen Organisation, die auf Planung und Vorausschau beruht, entwickeln sich informelle Strukturen emergent und diffus. Dennoch: Es führt kein Weg daran vorbei, die eigentlichen Einflussgrößen für die Leistungsfähigkeit von Organisation zu verstehen. Denn damit sich Mitarbeiter nicht nur informell, sondern auch formell aktiv engagieren und auch über den Tellerrand ihrer eigenen Abteilung hinaus wirken, müssen sie dazu kooperative Strukturen vorfinden.
All das ruft nach echter Partizipation. Nur wer tatsächlich eingebunden wird, übernimmt Verantwortung. Und wer Verantwortung wahrnimmt, erkennt Reformbedarf und setzt sich dafür ein, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen. Angenehmer Nebeneffekt: Überbordende Bürokratie wird zurückgedrängt, Mitarbeiter sehen mehr Sinn im eigenen Handeln und tragen deutlicher und unmittelbarer zum Unternehmenserfolg bei. Kurz: Das Engagement der Menschen steigt.
Das ist keine sozialromantische Vorstellung, sondern macht auch unter nüchterner Faktenlage Sinn: Zahlreiche Studien belegen den Zusammenhang zwischen unternehmerisch denkenden Mitarbeitern und der Innovationskraft sowie dem wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Betriebe mit hoch engagierten Mitarbeitern erbringen mehr und besseren Output, haben loyalere Kunden und erbringen insgesamt eine bessere finanzielle Performance.
Partizipation bedeutet mehr, als an regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen teilnehmen zu dürfen, deren Ergebnisse die Unternehmensführung mehr oder weniger konsequent umsetzt. Stattdessen geht es um echte Teilhabe an Entscheidungen und um Übernahme von Verantwortung für getroffene Beschlüsse. Damit es soweit kommt, müssen Unternehmen Mitarbeitern ein breites Spektrum von Rechten und Pflichten – auch in strategischen Angelegenheiten – übertragen. Ein erster Schritt ist das Niederreißen bestehender Informations- und Kooperationshemmnisse im Unternehmen: Daten- und Abteilungssilos müssen aufgebrochen, Fürstentümer abgeschafft werden. An ihrer Stelle sollen transparente, offene Informations- und Kommunikationsplattformen entstehen.