Problempunkt
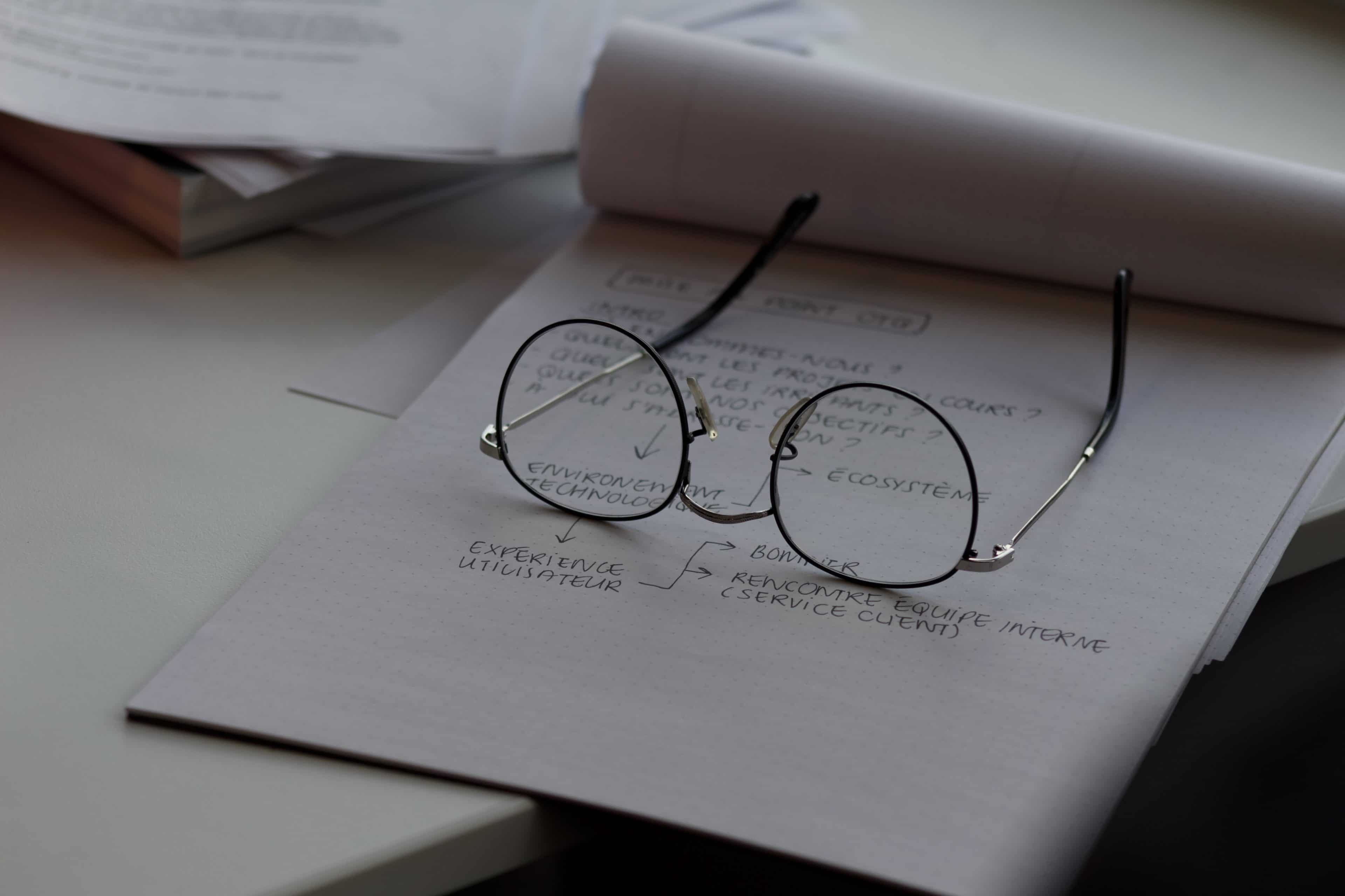
Die Parteien streiten um materiellen und immateriellen Schadensersatz im Hinblick auf eine von der Klägerin geltend gemachte Diskriminierung bei einer Beförderungsentscheidung. Die schwerbehinderte Klägerin ist staatlich geprüfte Betriebswirtin und war bei dem beklagten Arbeitgeber, einem Inkassounternehmen, als Personalreferentin beschäftigt. Sie bewarb sich hausintern erfolglos um die Stelle eines Personalleiters. Stattdessen wurde ein männlicher Kollege mit der Aufgabe betreut.
Im Prozess trug die Klägerin vor, alle 27 Führungspositionen auf der obersten Hierarchieebene seien nur mit Männern besetzt, obgleich die Gesamtbelegschaft zu zwei Dritteln aus Frauen bestehe. Der Beklagte machte geltend, Voraussetzung für die Position des neuen Personalleiters sei ein einschlägiges Universitätsstudium mit Schwerpunkt Personalwesen oder ein juristisches Studium gewesen. Dieses Anforderungsprofil hatte er jedoch nach außen hin nicht kommuniziert.
Im Rahmen der vorgerichtlichen Auseinandersetzung legte man der Klägerin u. a. nahe, über ihre berufliche Zukunft nachzudenken, ihre arbeitsvertraglichen Pflichten einzuhalten, obwohl keine Pflichtverletzungen vorlagen, künftig per Videoschaltung an Konferenzen teilzunehmen, obgleich dies für eine andere Arbeitnehmerin mit entsprechendem Anfahrtsweg nicht galt, und sich zu überlegen, ob sie einen lang andauernden Prozess gesundheitlich durchstehe. Die Klägerin hatte zuletzt im Wesentlichen materiellen Schadensersatz i. H. d. Vergütungsdifferenz zwischen ihrer Vergütung und der Vergütung der höherwertigen Stelle beantragt sowie eine Entschädigung nach Ermessen des Gerichts, mindestens jedoch 90.000 Euro. Das Arbeitsgericht Berlin wies die Klage ab.
Entscheidung
Die Berufung der Klägerin hatte teilweise Erfolg. Das LAG Berlin-Brandenburg sprach ihr die Vergütungsdifferenz zwischen ihrer derzeitigen Vergütung und der Vergütung der höherwertigen Stelle zu. Dieser auf § 15 Abs. 1 AGG gestützte materielle Schadensersatzanspruch ist nach den Ausführungen des Gerichts zeitlich nicht begrenzt. Weiterhin verurteilten die Richter den beklagten Arbeitgeber, eine Entschädigung wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts i. H. v. 20.000 Euro zu zahlen (§ 823 BGB i. V. m. Art. 1, 2 Grundgesetz – GG).
Für die Entscheidung ist die Beweislastregel des § 22 AGG von maßgeblicher Bedeutung. Wenn im Streitfall eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grunds vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass sie nicht gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung verstoßen hat. Die unwidersprochenen statistischen Angaben der Klägerin zur Besetzung der Führungspositionen genügten dem Gericht als ausreichendes Indiz für eine Geschlechtsdiskriminierung. Das LAG führte aus, dass es richterrechtlich keinen Zwang zu einer Frauenquote einführen will. Jedem Arbeitgeber steht es auch weiterhin frei, Führungspositionen ausschließlich mit Männern zu besetzen. In einer gerichtlichen Auseinandersetzung muss er dann aber in der Lage sein, die Gründe für die Bevorzugung eines Mannes nachvollziehbar zu belegen. Die Berücksichtigung von Statistiken als Indiz soll dazu führen, dass Arbeitgeber die Auswahlentscheidung nachvollziehbar gestalten.
Der Vortrag des Beklagten, das Anforderungsprofil des neuen Personalleiters setze ein einschlägiges Universitätsstudium voraus, vermochte die von der Klägerin geltend gemachten Indizien nicht zu erschüttern, da er dieses Anforderungsprofil im Bewerbungsverfahren nicht kommuniziert hatte. Nach den Ausführungen des LAG kann sich der Arbeitgeber zur sachlichen Rechtfertigung der Beförderungsentscheidung nur auf diejenigen Tatsachen berufen, die er zuvor im Auswahlverfahren nach außen hin ersichtlich gemacht hat.
Mangels eines berücksichtigungsfähigen Gegenvortrags ging das Gericht davon aus, dass die Klägerin bei diskriminierungsfreier Auswahl die am besten geeignete Bewerberin gewesen wäre. Der vom Beklagten nach § 15 Abs. 1 AGG zu leistende materielle Schadensersatz ist nach Auffassung der Richter zeitlich nicht begrenzt. Den Entschädigungsanspruch stützte das LAG auf eine Persönlichkeitsrechtsverletzung nach § 823 BGB i. V. m. Art. 1, 2 GG. Durch die Benachteiligung der Klägerin bei der Beförderung wegen ihres Geschlechts hat der Arbeitgeber ihre beruflichen Fähigkeiten herabgewürdigt und zugleich ihre Würde als Person verletzt. Bei der Höhe der Entschädigung berücksichtigte das Gericht insbesondere den bereits aufgelaufenen materiellen Schaden von 28.214,66 Euro sowie künftige monatliche Schadensersatzbeträge von 1.467,86 Euro.
Konsequenzen
Beide Parteien können gegen das Urteil Revision einlegen. Obgleich mit einer höchstrichterlichen Entscheidung zu rechnen ist, lohnt es, sich bereits jetzt mit den aufgeworfenen Rechtsfragen zu beschäftigen. Sollte die Rechtsauffassung des LAG Bestand haben, kommen auf den Arbeitgeber erhebliche Kosten zu. In einer bisher ungewohnten Deutlichkeit hat das Gericht in der zentralen Frage der Beweislastgrundsätze einen bloßen Statistikbeweis ausreichen lassen. Nach seiner Auffassung lässt das Phänomen der „gläsernen Decke“ den Schluss zu, dass in einem solchen Unternehmen eine Kultur herrscht, die die Chancengleichheit von Frauen beschneidet. Dieser Rechtswirklichkeit hat es die Beweislastgrundsätze angepasst, mit der Folge, dass – zumindest in einem eindeutigen Fall wie dem vorliegenden – ein bloßer Statistikbeweis als Indiz für eine Diskriminierung i. S. d. § 22 AGG ausreicht. Die Verteidigung kann der Arbeitgeber nur mit Tatsachen aufbauen, die er bereits im Bewerbungsverfahren kommuniziert hat.
Das LAG hat der Klägerin den materiellen Schadensersatzanspruch zeitlich unbegrenzt zugesprochen. Dies entspricht nicht der überwiegend in der Literatur vertretenen Auffassung (zu den unterschiedlichen Begründungsansätzen vgl. Bauer/Göpfert/Krieger, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, § 15 Rdnr. 23 ff. m. w. N.). Insbesondere lehnte es das Gericht ab, den Schadensersatz bis zu einer unterstellten frühestmöglichen Kündigung zu begrenzen. Eine solche kommt nach Auffassung der Richter allenfalls in Betracht, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis sowohl mit dem bevorzugten Bewerber als auch mit der diskriminierten Bewerberin rechtmäßig aus betriebsbedingten Gründen beendet hätte.
Praxistipp
Unternehmen, in denen ab einer bestimmten Hierarchieebene ein bestimmtes Geschlecht (zumeist Frauen) nicht vertreten oder stark unterrepräsentiert ist, sollten die Anforderungsprofile der ausgeschriebenen Stellen deutlich kommunizieren. Eine Statistik kann Beleg für eine diskriminierende Unternehmenskultur sein, muss es aber nicht, da statistische Verteilungen auch auf Zufälligkeiten beruhen können. Denkbar ist bspw., dass die abgelehnte Mitbewerberin die erste war, die sich um einen Führungsposten bei dem betroffenen Unternehmen bemüht hat. Möglich ist auch, dass die bisherigen Bewerberinnen schlechter qualifiziert waren als ihre männlichen Konkurrenten. Bei einer entsprechenden Fallkonstellation kann ein gegensteuerndes, offensives Personalmarketing hilfreich sein: „Wir sind insbesondere bemüht, auch qualifizierte Frauen anzusprechen und fordern diese zur Bewerbung auf!“
Das Gericht geht in seiner Entscheidung von einer Bestenauslese aus. Das ist nicht zwingend. Der Arbeitgeber der Privatwirtschaft ist dazu nicht verpflichtet. Er kann bspw. auch Mitarbeiter suchen „die zu ihm passen“. Dies sollte er dann allerdings im Rahmen seiner Personalakquisition nach außen hin deutlich machen, z. B. durch einen Hinweis auf die Unternehmenskultur, die unternehmerische Vision, besondere Vorerfahrung oder Engagement etc.). Die Entscheidung für einen „passenden“ Kandidaten ist damit notwendigerweise eine Entscheidung gegen die Mitbewerber. Die im Streitfall dann ggf. notwendige Entscheidungsbegründung verschiebt sich daher völlig: Es wird die besondere Eignung des Ausgewählten hervorgehoben und nicht vorrangig die Nichteignung des Abgelehnten.
Die Feststellungen des LAG dokumentieren zahlreiche Persönlichkeitsrechtsverletzungen der Klägerin. Jeder Arbeitgeber sollte sich darüber im Klaren sein, dass Arbeitsrechtsstreitigkeiten vor höherinstanzlichen Gerichten eine nicht zu unterschätzende Öffentlichkeitswirkung haben. Es empfiehlt sich deshalb, die Möglichkeit der Mediation, insbesondere der einvernehmlichen Trennung, im Auge zu behalten.
Quelle: Arbeit und Arbeitsrecht – Personal-Profi – 2/09







