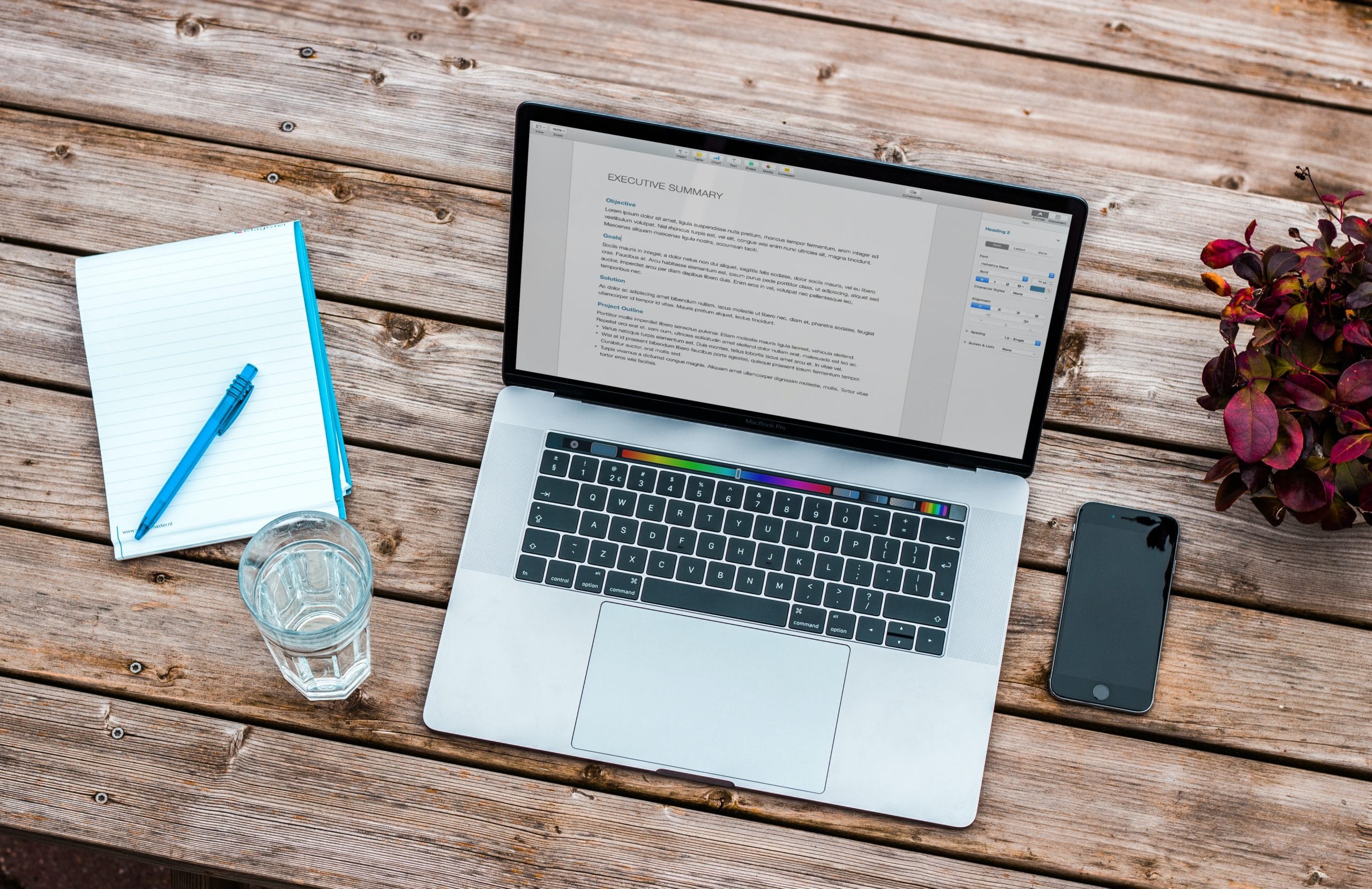Bis zum Jahr 2019 war es für eine Arbeitnehmerin nicht in jedem Fall möglich, “gefahrlos” im Job eine zeitlang kürzer zu treten, also in Teilzeit zu arbeiten. Denn es gab keinen allgemein gültigen Anspruch darauf, nach der Teilzeitphase wieder in den Vollzeitjob zurückkehren zu können. Seit 2019 ist das anders. Ab einer bestimmten Mindestgröße des Betriebs hat die Arbeitnehmerin einen gesetzlichen Anspruch auf die so genannte Brückenteilzeit.

Was bedeutet die Brückenteilzeit für Betrieb und Mitarbeiterinnen?
Brückenteilzeit bedeutet, dass die Arbeitnehmerin mindestens 12 Monate und höchstens 5 Jahre in Teilzeit gehen kann. Mit dem Instrument der Brückenteilzeit kommt der Gesetzgeber den Mitarbeitenden entgegen, die sich mehr Flexibilität in der Lebensplanung wünschen. Das Unternehmen kann diesen Teilzeitbeschäftigungswunsch nur in Ausnahmefällen, also aus schwer wiegenden betrieblichen Gründen, verweigern. Wer also mehr Zeit haben möchte für die Kinder, die Pflege eines Angehörigen, oder auch ganz ohne speziellen Grund in Brückenteilzeit gehen möchte, hat nun ein Anrecht darauf, hinterher zum ursprünglichen Beschäftigungsumfang zurückzukehren. Das war speziell bei Teilzeitwünschen ohne “triftigen” Grund bisher nicht so. Während nach einer Elternzeit oder Pflegezeit auch früher schon ein Rückkehrrecht zum ursprünglichen Arbeitszeitvolumen bestand, konnte die Teilzeitlerin, die ohne speziellen Anlass ihre Arbeitszeit temporär verkürzte, keine automatisches Rückkehrrecht in den vorherigen Arbeitsumfang geltend machen. Das Gesetz gab lediglich vor, dass sie bei der Vergabe von Vollzeitstellen bevorzugt zu behandeln war.
Kann das Unternehmen einen Wunsch nach Brückenteilzeit ablehnen?
Aus verschiedenen Gründen kann ein Unternehmen einen Antrag auf Brückenteilzeit ablehnen.
1. Mitarbeiterinnenzahl: Beschäftigte in Unternehmen bis einschließlich 45 regelmäßig angestellte Mitarbeiterinnen haben keinen Anspruch auf Brückenteilzeit. Mit dieser Begrenzung sollen unzumutbare Belastungen für kleine Unternehmen vermieden werden. Zu den 45 Mitarbeiterinnen zählen alle Beschäftigten, abzüglich der Auszubildenden. Bei dieser Berechnung wird aber nicht nur die Zahl der momentan beschäftigten Mitarbeiterinnen berücksichtigt. Hat das Unternehmen über einen längeren Zeitraum gesehen regelmäßig mehr als 45 Mitarbeiterinnen in Arbeit, muss dieser Umstand mit einbezogen werden.
2. Arbeitsablauf und Organisation: Wird ein Unternehmen erheblich im seinem Ablauf beeinträchtigt durch die geplante Brückenteilzeit eines Mitarbeiters oder verursacht die geplante Teilzeit dem Betrieb unzumutbare Mehrkosten, kann die Arbeitgeberin den Teilzeitwunsch ablehnen. Der Grund für die Verweigerung ist dabei schlüssig darzulegen.
3. Beschäftigungszeit: Ist die Mitarbeiterin weniger als 6 Monate im Betrieb beschäftigt, besteht noch kein Anspruch auf Brückenteilzeit. Gleiches gilt, wenn der letzte Wiedereinstieg einer Mitarbeiterin nach einer Teilzeitphase weniger als 12 Monate zurückliegt.
4. Zumutbarkeitsgrenze: In Unternehmen von 46 bis 200 Beschäftigten wird die Summe der Mitarbeiterinnen durch 15 geteilt und das Ergebnis auf eine volle Zahl aufgerundet. Daraus ergibt sich die zumutbare Zahl an Mitarbeiterinnen, die im betreffenden Betrieb in Brückenteilzeit arbeiten können. Normale Teilzeitkräfte bleiben bei der Berechnung dieser Zumutbarkeitsgrenze außen vor.
5. Abstand zu einer vorausgegangenen Ablehnung: Seit der Ablehnung eines Antrags auf Brückenteilzeit aus betrieblichen Gründen müssen mindestens 24 Monate vergangen sein, bevor ein neuer Antrag gestellt werden kann.
Was muss die Arbeitnehmerin beachten, wenn sie den Antrag stellt?
- Frist: Der Antrag muss mindestens 3 Monate vor dem gewünschten Beginn der Brückenteilzeit gestellt werden. Umso früher der Antrag gestellt wird, umso leichter gelingt dem Unternehmen die Planung.
- Form: Der Antrag muss schriftlich gestellt werden.
- Inhalt: Der Antrag muss ausdrücklich den Wunsch nach einer Brückenteilzeit enthalten. Weiterhin zu nennen sind: Das gewünschte Arbeitsvolumen, das Anfangs- und Enddatum der Teilzeitvereinbarung sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage.
Was muss die Arbeitgeberin beachten, wenn sie den Antrag begutachtet?
Das Unternehmen ist verpflichtet, den Antrag zu prüfen und der Antragstellerin mitzuteilen, ob es dem Antrag zustimmt. Im Falle einer Ablehnung ist ausführlich darzulegen, warum dies geschieht. Dies alles ist schriftlich und mindestens 1 Monat vor Beginn der gewünschten Teilzeit mitzuteilen. Wird diese Frist versäumt, gilt der Antrag als genehmigt.
Wichtig: Sollte das Unternehmen den Antrag ohne eine stichhaltige Begründung ablehnen, kann die Arbeitnehmerin beim Arbeitsgericht Klage einreichen.
Was ist noch wichtig?
- Vertrag ist Vertrag: Die getroffenen Vereinbarungen gelten für die gesamte Brückenteilzeit. Es besteht kein rechtlicher Anspruch darauf, die Länge der Brückenteilzeit zu verändern oder die vereinbarte Arbeitszeit zu korrigieren.
- Bedingtes Rückkehrrecht: Die Brückenteilzeit beinhaltet zwar das Recht in den früheren Beschäftigungsumfang zurück zu kehren, sie garantiert aber keinesfalls die Rückkehr an den gleichen Arbeitsplatz. Es kann vom Unternehmen auch ein anderer, als gleichwertig anzusehender Arbeitsplatz bereit gestellt werden.
- Miteinander reden: Auch wenn im Hinblick auf die Brückenteilzeit verbindliche gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen wurden, lohnt es sich nicht immer auf das vermeintliche persönliche Recht zu pochen. Rechtsstreitigkeiten kosten Zeit, Geld und Motivation. Wenn aber sowohl das Unternehmen als auch die Arbeitnehmerin im Konfliktfall bereit sind, miteinander nach einer Lösung zu suchen, lassen sich auch schwierige Fälle mit einem guten Kompromiss lösen.