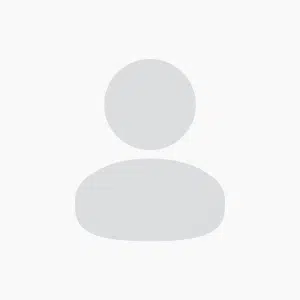Am Ende geht es um Geld für Übernahme
Es dürfte den Familienbetrieben jedoch zum Teil schwer fallen, diesen Spielraum mit gutem Willen zu eröffnen. Die EY-Studie zur Nachfolge zeigt nämlich auch, dass potenzielle Nachfolger besonders hohe Preisnachlässe auf Übernahmen erwarten. Zum Vergleich: Im weltweiten Durchschnitt wollen Nachfolgegenerationen familieneigene Unternehmen ungefähr für die Hälfte jenes Preises erstehen, den ein externer Käufer auf den Tisch legen müsste. In Österreich verlangen die Interessenten einen Preisnachlass von 59 Prozent.

Personalisten und Recruiter aus der Privatwirtschaft dürften diese Ergebnisse Aufwind geben. Wer Absolventen aus Familienbetrieben mit seinen Werbemaßnahmen adressiert, trifft öfter als manchmal den Nagel auf den Kopf.
Familienbetriebe ganz groß
Die größten Familienbetriebe hat das Wirtschaftsblatt jüngst zusammengetragen und nach Umsätzen gereiht; es sind insgesamt 19. In dieser Liga rangieren Porsche Salzburg, Spar, Andritz und Red Bull an vorderster Front. Die Salzburger Porsche und Spar beschäftigen zusammen 72.000 Mitarbeiter. Andritz kommt auf 25.000 Beschäftigte.
Diese starke Riege bildet die eine Seite der Familienwelt in der Wirtschaft. Auf der anderen Seite stehen jedoch tausende Betriebe, in denen Eltern neben Kindern und Angestellten an der Theke, am Servicetelefon oder in der Produktion arbeiten. Für sie haben typische Familienbetriebsfragen ein ganz anderes Gewicht: Aus welchem Familienstamm soll der Nachfolger kommen? Wie würde sich die Bestellung eines externen Managers auf das Geschäft auswirken? Wie wird das Eigentum an der Firma in der Familie verteilt? Was passiert, wenn der Nachwuchs die Nachfolge nicht antreten will?
Die EY-Studie greift sensible Aspekte aus diesem Themenkreis speziell zur Nachfolge auf. Einerseits gibt es nämlich zwar immer mehr akademisch gebildete junge Menschen, andererseits sind Familienbetriebe weniger attraktiv für diese angehenden Arbeitnehmer, als sich die Unternehmer das zum Teil wünschen würden.
Die Umfrage konnte die Befindlichkeiten der Studierenden – schwerpunktmäßig aus den Wirtschafts-, Rechts- und Naturwissenschaften – dazu im Detail klären. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Befragten der Unterschiede zwischen Familien- und Privatwirtschaft äußert bewusst sind. Bei knapp einem Drittel der 4.217 befragten Studenten (43,1 Prozent) ist das allzu natürlich. Sie sind in einer Familie groß geworden, die einen oder mehrere Betriebe besitzt. Für diese spezielle Zielgruppe hat EY Details ermittelt.
Familienkonkurrenz: Gute Konjunktur, Karrierevielfalt, Stolz
Der Studie zufolge kämpfen etliche Familien damit, dass gute Konjunkturlagen in einzelnen Ländern, vielfältige Karrieremöglichkeiten oder die Familiensituation sowie Stolz die Kinder in die Welt hinausziehen. Außerdem komme hinzu, dass der von den Eltern geerbte Unternehmergeist die betroffenen Jüngeren motiviere, selbst ein Business in Eigenregie umzusetzen, so die Studienautoren.
Die weiteren zentralen Studienergebnisse:
>> 3,5 Prozent der 1.438 Teilnehmer wollen direkt von der Hochschulbank
in ihren Familienbetrieb wechseln.
>> 22,7 Prozent möchten lieber im Anschluss an ihr Studium in einem
großen privaten Unternehmen bzw. Konzern arbeiten.
>> 59,7 Prozent streben ein Angestelltenverhältnis
in der Privatwirtschaft an.
Positiv motiviert werden die Jungen offenbar von der Betriebsgröße der Familienbetriebe: Bei Unternehmen mit zwei bis fünf Mitarbeitern wollen nur 5,2 Prozent spätestens fünf Jahre nach dem Hochschulabschluss einsteigen, bei jenen mit mehr als 100 Mitarbeitern immerhin 16,3 Prozent.
Frauen suchen Zukunft außerhalb der Familie
Die Studie erhob auch mögliche Präferenzunterschiede zwischen allen männlichen (34,7 Prozent) und weiblichen Teilnehmern (65,3 Prozent) in der Zielgruppe der Familienbetriebssprößlinge. Demnach suchen potenzielle Nachfolgerinnen eher nach Karrieremöglichkeiten außerhalb des Familienbetriebs. Unabhängig von der Studienrichtung ist der Anteil von Frauen, die sich einen Einstieg vorstellen können, um ein Viertel geringer als jener der Männer. Für Johannes Volpini, Partner für den Bereich „Family Business“ bei EY Österreich, hat diese Tatsache viele Gründe: „Das lässt sich einerseits dadurch erklären, dass es in vielen Fällen immer noch Usus ist, die Nachfolge gemäß dem Erstgeburtsrecht zu regeln – der älteste Sohn übernimmt automatisch den Betrieb. Dazu kommt, dass männliche Studenten deutlich selbstbewusster bei der Einschätzung ihrer unternehmerischen Fähigkeiten sind und Entrepreneurship als weniger riskant einstufen.“ Volpini empfiehlt Familienbetrieben, potenziellen Nachfolgern in und außerhalb der Familie Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. Sie müssten die Entfaltung und Fortführung des Kerngeschäfts ausbalancieren.
Foto: Sandra Heß | pixelio.de
Auch wenn die Mehrheit der Menschen in westlichen Gesellschaften die Familie als Lebensgemeinschaft nicht mehr konsequent als Hausgemeinschaft versteht, so begreifen viele sie doch immer noch als Kreis von Verwandten und Lebensgefährten. Und in diesem gelten zum Teil eigene soziale Spielregeln. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht sich die Beteiligten verstehen, können familiäre Bindungen Segen oder unglückliche Verstrickungen bedeuten; jeweils potenziert dadurch, dass die Beteiligten auch zusammen wirtschaften.
In Österreich erleben verschiedenen Statistiken zufolge rund 70 Prozent aller heimischen Arbeitnehmer, was es bedeutet, in oder bei einer Familie zu arbeiten; wobei das Betriebsklima je nach Belegschaftsgröße jenes der großen Welt sein kann. Weniger eindeutig als die Beschäftigtenzahl ist die Quote der Betriebe im Familienbesitz an der Gesamtunternehmenszahl. Die EY-Studie spricht von 80 Prozent, die KMU Forschung Austria beziffert die Zahl unter Berücksichtigung der EU-Definition (= Familienunternehmen im weiteren Sinn) auf 90 Prozent. In diesem Satz sind auch alle Ein-Personen-Unternehmen berücksichtigt (laut Wirtschaftskammer Österreich: 278.411).